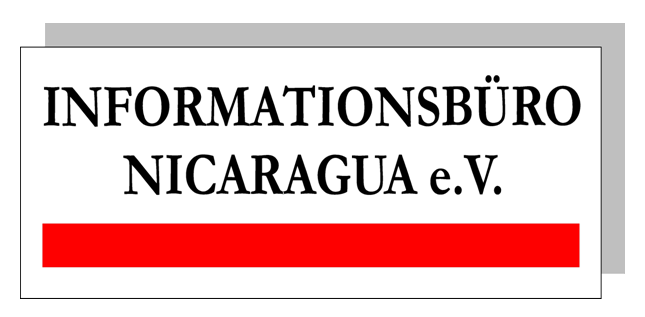Wenn man es nicht weiß, kann man leicht darüber hinwegsehen. Wer als wenig informierte:r Tourist:in nach Nicaragua kommt, wird nichts von den repressiven Maßnahmen der Ortega-Murillo-Diktatur merken. Auf der Oberfläche sieht man, was die Regierung zeigen will: Normalität.
Vielleicht wundert man sich, dass auf den Fernstraßen alle paar Kilometer Polizeistreifen stehen. Aber sie halten einen auch nicht an, wenn man nicht zu schnell fährt oder waghalsig überholt. Sie stehen da, zwei oder drei Polizist:innen in den blauen Uniformen der nationalen Polizei sowie ein oder zwei in schwarzen Uniformen und mit Gewehr. Gewehre bei Verkehrskontrollen? Scheint hier üblich zu sein. Brisant wird es, wenn man weiß, dass die schwarzen Uniformen von den antimotines benutzt werden, von den Spezialtruppen zur Aufruhrbekämpfung. Um unachtsame Fahrer:innen zu kontrollieren, werden sie nicht gebraucht. Wohl aber zur Einschüchterung, alle paar Kilometer.
Auch wird nicht jede:r gleich Böses denken, wenn im vollbesetzten Restaurant einer touristischen Stadt auf einmal am Nebentisch ein einzelner Mann sitzt, Nicaraguaner, mit zwei Handys und Bürstenhaarschnitt und mit direktem Blick auf eine Gruppe aus Ausländer:innen und Nicaraguaner:innen. Vielleicht hat er ja auch nur Hunger. Aber irgendwie passt er nicht ins Bild, mit seiner Ausstrahlung eines Angehörigen des Sicherheitsapparates in Zivil. Und wenn bald darauf in einer anderen Stadt wieder so ein einzelner Mann am Nebentisch auftaucht, dann ist das wohl kaum ein merkwürdiger Zufall, selbst wenn man nicht mitbekommt, dass er mit dem Handy Fotos von der Gruppe macht. Auch wenn es keine unmittelbaren konkreten Folgen hat – dass Ausländer:innen und Nicaraguaner:innen sich mischen, ist per se verdächtig. Und dass über den Städten Drohnen kreisen, ist auch nicht das Werk von Hobbypilot:innen. Die Überwachung ist enger, als man denkt.
Das alles ist noch die Oberfläche, mit kleinen Rissen, die nur für manche erkennbar sind. Hat man die Gelegenheit, tiefer einzutauchen, ins Gespräch zu kommen, vielleicht sogar irgendwo ein Stückchen mitzuleben, dann wird man schnell gewahr, dass die Normalität der Oberfläche trügt. Die Menschen sind durchweg unzufrieden, tragen eine unterdrückte Wut mit sich und leben im Dauerzustand einer latenten Spannung, die gelegentlich in regelrechte Stresssituationen umschlägt, und das alles darf keinen Ausdruck finden in der Öffentlichkeit, und gegenüber Fremden in allenfalls sehr verhaltener Form.
Fühlt man irgendwo mal ein bisschen vor, zum Beispiel mit der Frage, wer in diesem oder jenem Ort die kommunale Verantwortung trägt, bekommt man nicht etwa zu hören: ‚die FSLN, die die Kommunalwahl gewonnen hat‘, sondern „die vorherrschende Partei“ oder „Na, wer schon?“. Ein Geschäftsmann wird etwas deutlicher: „Wenn ich den Mund aufmache, verliere ich meine Lizenz.“ Konformität wird mit ökonomischem Druck durchgesetzt. Eine Marktfrau: „Es ist nicht zum Aushalten.“
Tief getroffen hat einen Großteil der Bevölkerung das Verbot von Prozessionen als Maßnahme, die letzte verbleibende unabhängige Institution, die katholische Kirche, in ihrem Handeln einzuschränken. Gerade die Kreuzwege während der Passionszeit sind eine zentrale Ausdrucksform der katholischen Volksfrömmigkeit. Dass es sie nicht mehr geben soll – oder höchstens reduziert auf einen Rundgang im Kirchengebäude selbst -, weckt nicht nur Unverständnis, sondern Wut. Und als die Kirche anlässlich einer Priesterweihe voll besetzt ist, wird sie von einem massiven Polizeiaufgebot umringt. Die Angst vor Menschenansammlungen, die nicht von der vorherrschenden Partei kontrolliert werden, ist bei eben dieser gewaltig.
Auch im familiären Bereich herrscht eine durch die Umstände geschürte Spannung, die gelegentlich in Stress umschlägt. Viele Familien bestreiten einen Gutteil ihres Lebensunterhaltes mit Zahlungen, die sie von im Ausland arbeitenden Angehörigen erhalten, die remesas genannt werden. Läuft dann das Gerücht um, die Regierung würde den US-Dollar massiv abwerten, seinen Umtauschkurs von 1 zu 36 Córdobas auf 1 zu 20 reduzieren, würde das praktisch eine Halbierung der Unterstützung bedeuten, und das bei ständig steigenden Preise. Dann wieder gibt es Gerüchte, die remesas würden nur teilweise oder nur in Córdoba ausgezahlt oder bei den Banken ließen sich keine Dollars mehr abheben, was diejenigen träfe, die etwas von den remesas angespart haben. Ob diese Gerüchte Versuchsballons der Regierung sind, um die Reaktionen in der Bevölkerung vorab zu testen, oder Fakenews der Opposition, um das Land zu destabilisieren, wer weiß. Aber für die Leute bedeutet es einen sich immer wiederholenden Stress, wenn ihre Lebensgrundlagen in Gefahr zu geraten drohen.
Eine andere Quelle, die Stress verursacht, sind die Regelungen zur Ein- und Ausreise. Man stelle sich vor, wie es ist, wenn jemand, der ins Ausland reist, dort die Mitteilung erhält, er oder sie dürfe nicht nach Nicaragua zurückkehren. Ohne Begründung. Für die betroffene Person ist es ein erzwungenes Exil, abgeschnitten von familiären, sozialen, ökonomischen Netzen, ohne Möglichkeit, die alten Eltern noch einmal zu sehen. Und für die Familie im Land ist es fast wie ein Trauerfall, der Verlust eines Menschen auf unbestimmte Zeit, der plötzliche Wegfall von Gemeinschaft und Unterstützung. Und zugleich die Ungewissheit, ob man selbst noch reisen kann. Für Menschen im Staatsdienst ist das schon klar. Ein Bekannter, der im Bildungssektor arbeitet, erhielt einen Brief, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass er Auslandsreisen vorher anmelden muss und dass Reisen in die USA und nach Kanada grundsätzlich verboten sind. Viele haben Angehörige in den USA, Geschwister, Ehepartner, Kinder, die sie nun nicht mehr besuchen können. Und wenn er trotzdem fliegen würde? Dann würde er nicht nur seinen Job verlieren, sondern auch seine Pensionsansprüche. Das lasse man sich auf der Zunge zergehen: Da hat jemand 30 oder 40 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt, und dann wird die Altersversorgung aus politischen Motiven einfach gestrichen. Wer Angehörige in gehobenen Funktionen bei Regierung, Militär oder Polizei hat, muss sowieso damit rechnen, gar nicht ausreisen zu dürfen.
Der ökonomische Stress und der Druck im Reisebereich sind nur zwei markante Beispiele für Verunsicherung und Stress. Allgemein spricht man bei bestimmten Themen selbst im Haus mit gedämpfter Stimme, und in Telefonaten und elektronischen Nachrichten versucht man, Namen, Orte und Daten zu vermeiden. Man weiß nie, wer mithört bzw. mitliest. Die Repression prägt den Alltag mit.
Und die 20 Prozent der Bevölkerung, die an den letzten Kommunalwahlen teilgenommen und für die FSLN gestimmt haben? Sind die wenigstens zufrieden? Ein beträchtlicher Teil von ihnen sind Lehrer:innen, Gesundheitsarbeiter:innen und Mitarbeitende der Verwaltung und anderer staatlicher Einrichtungen. Zur Wahl mussten sie gehen und für die vorherrschende Partei stimmen, um ihren Job zu behalten. Viel nerviger aber ist, dass sie fast jeden Samstag zu einer Jubelfeier oder einem ‚freiwilligen‘ Arbeitseinsatz beordert werden. Der Unmut hinter vorgehaltener Hand ist groß. Eine Krankenschwester erzählt, dass fast alle Ärzte, die sich das leisten können, gekündigt haben. In der Konsequenz werden Operationen von Mediziner:innen durchgeführt, die frisch von der Uni kommen, mit entsprechenden verheerenden Konsequenzen. Der permanente Druck, durch Wohlverhalten den eigenen Arbeitsplatz, den eigenen Posten sichern zu müssen, ist überall ungeheuer, bis hinein in die hohen Chargen.
Wenn man es recht betrachtet, so stehen, wenn auch auf unterschiedliche Weise, alle unter Druck: die regimekritischen Menschen, die Teile der Bevölkerung, die sich herauszuhalten versuchen, diejenigen, die die Regierung unterstützen (müssen), die Funktionäre selbst. Der Druck auf dem Kessel ist gewaltig. Manche sagen, das kann nicht mehr lange so weitergehen, andere verweisen auf Kuba und Venezuela, wo es schon lange so weitergeht. Jedenfalls verwundern einen nicht die antimotines, alle paar Kilometer.