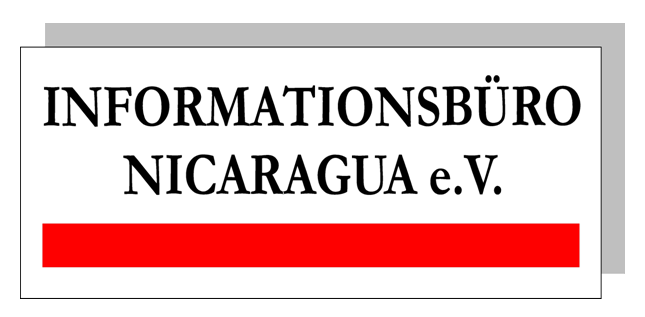Von Vilma Núñez de Escorcia (Übersetzung Christa Martin)
Artikel aus envío Nr. 387 von Juni 2014
http://www.envio.org.ni/articulo/4857

Vilma Núñez de Escorcia, Präsidentin des Nicaraguanischen Menschenrechtszentums (CENIDH), zeit ihres Lebens Vorkämpferin und Verfechterin der Menschenrechte, erläutert im Interview mit Envío ihre Überlegungen zu den Grenzen des Rechts auf Wahrheit in Nicaragua.
Was bedeutet Übergangsjustiz?
Mit diesem relativ neuen Begriff in der Menschenrechtslehre ist die Justiz gemeint, die in Ländern in einem Übergangsprozess von einer Diktatur zu einer Demokratie oder von einem bewaffneten Konflikt zum Frieden ermöglicht werden soll. Auf Nicaragua wären ganz klar einige der juristischen sowie außerjuristischen Strategien der Justiz in diesen schwierigen Übergangsphasen anwendbar. Sie lassen sich im Wesentlichen in drei Aspekten zusammenfassen:
- die Wahrheit erfahren
- Gerechtigkeit walten lassen
- die Opfer entschädigen.
In Nicaragua herrscht in dieser Hinsicht jedoch eine große Lücke, die wir alle als Gesellschaft zu verantworten haben. In den Übergangsprozessen, die wir durchlebt haben, ist praktisch alles ungesühnt geblieben, und wir stehen in der Schuld der Opfer.
Die Auseinandersetzung mit diesem Thema bedeutet eine Auseinandersetzung mit unserer Geschichte und mit der Frage, was geschah und warum es geschah. Ich muss zugeben, dass es mir emotional sehr schwer fällt, so viele schmerzhafte Situationen wieder zu durchleben. Die Jahre sind vergangen und bei vielem, wovon ich damals dachte, es müsse so sein, habe ich später gesehen, dass es durchaus nicht so sein musste. Ich denke mit widersprüchlichen Gefühlen daran zurück: Ich weiß nicht, ob es Fremdschämen, Mangel an Verantwortung aus Opportunismus oder Ohnmacht ist . Nur eins weiß ich mit Sicherheit, dass wir in Nicaragua in der Schuld sehr vieler Opfer von Menschenrechtsverletzungen aus unserer jüngeren Geschichte stehen. Ich will auf Menschenrechtsverletzungen aus drei Epochen unseres Landes eingehen: aus der Somoza-Diktuatur, der Zeit der Revolution und der Übergangsregierung von Doña Violeta [Chamorro].
Von den Grausamkeiten aus der Zeit Somozas hat sich mir eine erste Erinnerung unauslöschlich eingeprägt. Ich war sieben oder acht Jahre alt, als ich in Acoyapa, dem Dorf, wo ich geboren wurde, die Leute durch die Straßen hinter dem Leichenwagen herlaufen sah, in dem Rito Jiménez liegen sollte. Er und ein anderer Mann namens Orozco – den Vornamen weiß ich nicht mehr – waren Somozagegner. Das Regime hatte sie Jahre zuvor verschwinden lassen. Als ihre Leichen schließlich auftauchten, erfuhr man, was geschehen war: Sie waren gefangen genommen und in einem Kalkbrunnen des Bergwerks Libertad lebendig begraben worden. Ich erinnere mich, wie ich mit anderen Kindern aus dem Dorf hinter den Leuten herlief und diese grauenhafte Geschichte hörte. Dinge, die an so vielen Orten in unserem Land geschahen …
Somoza errichtete eine jahrzehntelange repressive Diktatur und verschärfte die Unterdrückung jedes Mal, wenn er sich bedroht fühlte. Die Mitglieder der Konservativen Partei und die Militärs der Nationalgarde, die bei den Ereignissen vom 4. April 1954 gegen ihn kämpften, wurden gefoltert und in den Kaffeeplantagen von Carazo gnadenlos ermordet. Ich erinnere mich noch ganz genau an das Massaker der Studenten auf den Straßen von León am 23. Juli 1959, denn an der Demonstration habe ich damals selbst teilgenommen. Ich erinnere mich an den Mord an Silvio Parodi und an David Tejada, dessen Leiche die Zivilgardisten in den Krater des Vulkans von Masaya warfen. Und als die Frente Sandinista in den Bergen und den Städten erstarkte, antwortete Somoza mit massiven Menschenrechtsverletzungen. Waslala steht symbolisch für diese schrecklichen Grausamkeiten.
Ich erinnere mich an den Fall der Familie Tijerino, die völlig ausgelöscht wurde. Die Nationalgarde lud ihre Opfer in Hubschrauber und stieß sie ins Leere, sodass sie verschwanden und für ihre Angehörigen nie wieder auffindbar waren. Außerdem gab es Vergewaltigungen von Bäuerinnen in massivem Ausmaß. Ich erinnere mich an den Bericht über die Schikanen, denen Doris Tijerino und Amada Pineda ausgesetzt waren. Diese Ereignisse schilderte Pater Fernando Cardenal sehr gut in seiner Rede vor dem Kongress der USA im Jahr 1976. Das war das erste Mal, dass man größere Anstrengungen unternahm, die Barbarei gegen Menschenrechte in Nicaragua vor der Weltöffentlichkeit zu verurteilen.
Die Interamerikanische Menschenrechtskommission (CIDH) wies diese und Hunderte weiterer Fälle nach, als sie vom 3. bis zum 12. Oktober 1978 Nicaragua besuchte. Ich war damals in einer Menschenrechtskommission in León und hatte die Aufgabe, sie zu betreuen. Dieser Bericht bezeichnete nicht nur die Somoza-Regierung als repressive und für massive Menschenrechtsverletzungen verantwortliche Diktatur, sondern veranlasste auch das 17. Beratungstreffen der Außenminister der OEA (Organisation der Amerikanischen Staaten), das am 18. Dezember 1978 in Washington stattfand. Zum ersten Mal in der Geschichte einer internationalen Organisation erklärte damals die OEA, dass „eine in einem Mitgliedstaat an der Macht befindliche Regierung aufgrund der Menschenrechtsverletzungen gegen ihre eigene Bevölkerung keine Legitimation“ besaß, und beschloss eine Resolution, deren erster Punkt „die sofortige und endgültige Absetzung des somozistischen Regimes“ war.
Bei dem Volksaufstand von 1978 beging das Somoza-Regime alle möglichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ich erinnere mich daran, dass Rot-Kreuz-Helfer ermordet wurden, als sie nach Chinandega fuhren, um den Opfern der von Somoza angeordneten Bombardements zur Hilfe zu kommen. In fünf oder sechs Städten Nicaraguas wurde die Bevölkerung Opfer von Flächenbombardements. Das habe ich in León erlebt, wo die Nationalgarde Bomben von 500 Pfund und mehr abwarf, die das historische Zentrum fast zu einem Trümmerfeld machten. Wo auch immer ein Aufstand aufkeimte, führte das Regime „Säuberungsaktionen“ durch: die Nationalgarde kam mit leichten Panzern, holte die Leute aus den Häusern und tötete die Männer. Ich erinnere ich an eine Massenerschießung 1978 in La Arrocera, am Ortsausgang von León. Auf Drängen der Frauenvereinigung AMPRONAC, deren Sprecherin Zoila Guadamuz war, gingen wir hin, um uns von dem Geschehen zu überzeugen. Uns bot sich ein Bild des Grauens: 27 verwesende Leichen von jungen Männern.
Die Somoza-Diktuatur hat sich permanenter und systematischer Menschenrechtsverletzungen schuldig gemacht, die völlig ungesühnt blieben. Damals eröffnete das Regime in einigen Fälle Verfahren und hielt Kriegsgerichte ab, doch am Ende wurde immer eine Selbstamnestie dekretiert. Damit wurden angeblich die Opfer befreit, aber das Ziel war, die Täter von Schuld freizusprechen. Und nach jeder Farce dieser Art ging die Repression weiter und die Grausamkeit des Regimes steigerte sich noch. Nach vielen Ansätzen und Kämpfen blieb dem Volk Nicaraguas kein anderer Weg, als diese Diktatur mit Waffengewalt zu stürzen.
Und so sind wir bei der Zeit der Revolution angekommen. Rasch, sehr rasch, allzu rasch tauchten bewaffnete Gruppen auf, die sich dem revolutionären Projekt widersetzten. Und kaum anderthalb Jahre später stand das Land vor einem Krieg. In den Jahren der Revolution und dieses Krieges begingen zwei Akteure Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, also gegen international geltendes Recht, das menschliches Leid in einem bewaffneten Konflikt vermeiden und begrenzen soll, humanitäre Normen, die sowohl für Regierungen als auch für die gegnerischen Seiten in einem Konflikt bindend sind. Einer dieser Akteure waren die beiden bewaffneten Institutionen der Revolution, das Sandinistische Volksheer und das Innenministerium, die im Kampf gegen die Gewaltexzesse der von den USA finanzierten Contras selbst Gewaltexzesse verübten. Der andere Akteur, der die Menschenrechte verletzte und Verbrechen gegen die Menschlichkeit beging, das waren diejenigen, die wir damals die Contra nannten.
Beide Seiten waren für schwerste Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich. Denke ich an die Taten der Institutionen der Revolution, so frage ich mich, ob ich etwas hätte tun können, um ihnen Einhalt zu gebieten. Ich glaube nicht. Hätten andere sie verhindern können? Ich weiß es nicht, aber wir alle, die wir uns ein Leben lang mit der Achtung der Menschenrechte identifiziert haben, werden das Gefühl nicht los, dass wir versagt haben, dass wir im Siegesrausch nach dem Sturz der Somoza-Diktatur und in der riesigen Hoffnung auf die revolutionären Veränderungen die Geschehnisse vielleicht kleingeredet, vielleicht ignoriert, vielleicht nicht einmal wahrgenommen haben …
An zahlreichen Fällen ist belegt, dass in den ersten Monaten der Revolution, noch vor Beginn des Krieges, die siegreichen militärischen Kräfte die Menschenrechte der Soldaten der besiegten Diktatur verletzten. Ich kann mich an einige dieser Fälle erinnern, weil wir in der Justiz, wo ich damals als Vizepräsidentin des Obersten Gerichtshofs arbeitete, auf die Achtung des Legalitätsprinzips und der von der Revolutionsregierung selbst als weiterhin gültig erachteten Gesetze pochen mussten. In einem der bekanntesten Fälle ging es um die Hinrichtung von ungefähr 24 Personen im Gefängnis La Pólvora in Granada. Und das war kein Einzelfall. Hinrichtungen im Schnellverfahren gab es auch in anderen Gefängnissen in verschiedenen Teilen des Landes.
Wie konnte eine Regierung, die ihre Legitimität aus dem Sieg über eine so blutige Diktatur herleitete, ähnlich schreckliche Taten begehen wie die, gegen die sie gekämpft hatte? 1981 verfasste die Interamerikanische Menschenrechtskommission (CIDH) einen Bericht über die Hinrichtungen in La Pólvora. Die Beschwerde wegen dieser Taten hielt sie gemeinsam mit Amnesty International bis zum Ende der Revolutionsregierung aufrecht. Und obgleich es einige Versuche gab, hier Recht zu sprechen, blieb in diesem Fall die Verletzung des Rechts auf Leben ungesühnt, und das, obwohl nicht einmal ermittelt werden musste, da die Opfer identifiziert und die Befehlshaber in Granada bekannt waren.
Als der oberste Befehlshaber des Generalstabs der Nationalgarde Somozas, Federico Mejía, aus dem Land floh, blieb General Fulgencio Largaespada als Führung der Garde zurück. In mehreren Dokumenten aus der damaligen Zeit ist belegt, dass General Humberto Ortega als Befehlshaber der Streitkräfte der Frente Sandinista mit ihm vereinbarte, diejenigen, die keine grausamen Verbrechen begangen hatten, in das neu zu aufzustellende Heer aufzunehmen. Ich habe noch die Anordnung mit dem Befehl von General Largaespada, dass die Mitglieder der Nationalgarde die Waffen abgeben und sich unter Anerkennung der Niederlage ergeben sollten. Darin wird ihnen auch Leben und körperliche Unversehrtheit garantiert. Zum Zeitpunkt der Kapitulation suchten über viertausend Nationalgardisten Asyl beim Roten Kreuz, höhere Ränge in Botschaften, manche flüchteten sich auch in Kirchen. Doch diese Vereinbarung wurde missachtet. Bewaffnete Kräfte der Frente Sandinista holten Nationalgardisten aus Gebäuden des Roten Kreuzes und aus Kirchen und warfen sie ins Gefängnis, einige in das von Modelo, andere in das der Freihandelszone. In dieser ersten Zeit waren über 6.500 Nationalgardisten in Haft. Nach und nach wurden sie freigelassen, zuerst eine Gruppe von 1.760 Mann. Einige Monate später meuterten die Gefangen in der Freihandelszone und protestierten gegen die miserablen Bedingungen in ihrem Gefängnis. Kräfte des Innenministeriums erstickten diesen Protest, indem sie in der Nacht vom 27. Juni 1981 sechzehn Gefangene töteten.
Sehr bald entstanden in ländlichen Gebieten bewaffnete Gruppen gegen die Revolution. Die Antwort waren Militäroperationen, bei denen ganz klar Menschenrechtsverletzungen begangen wurden. Der Fall Pantasma ist symptomatisch und hinterließ Spuren in der Revolution. Pantasma war Schauplatz massiver Strafmaßnahmen des Sandinistische Heeres gegen Bauern, die sich dem ihnen aufgezwungenen revolutionären Modell widersetzten. Auf Druck der CIDH und internationaler Institutionen hin verurteilte ein Militärgericht aus Vertretern des Innenministeriums und der Gerichtsbarkeit des Sandinistischen Volksheeres 42 Soldaten für diese Repression, und einige wurden wegen der Zahl ihrer Verbrechen zu 30 Jahren Haft verurteilt. Es gab auch andere unakzeptable Vorfälle, auch außerhalb der ländlichen Gebiete, in denen der Krieg herrschte. Ein Musterfall war die kaltblütige Ermordung des Industriellen, Unternehmervertreters und unerschütterlichen Oppositionellen Jorge Salazar. Der politische Preis dieses Verbrechens für die Revolution war enorm.
Die bewaffnete Oppostion gegen die Revolution begann an der Atlantikküste in den Miskitogebieten. Auch dort wurden schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, Fälle, die nicht abgeschlossen sind und ungesühnt blieben. Die Revolutionsführung verstand die Weltsicht der indigenen Miskitos nicht und die Miskitos übernahmen nie das Modell, das ihnen die Revolution aufzwang. Als Antwort auf die wachsende Unzufriedenheit ordnete die Revolutionsregierung Zwangsumsiedlungen der Zivilbevölkerung an der Atlantikküste an. Der bekannteste Fall war die massive Vertreibung von 42 Miskito-Gemeinschaften, die 1982 vom Río Coco nach Tasba Pri umgesiedelt wurden, eine Aktion, die als „Rote Weihnacht“ bekannt ist. Dabei starben viele Menschen und es gab zahlreiche Fälle von Willkür und Machtmissbrauch. Auch wenn die Regierung diese Aktion als Maßnahme zum Schutz der Zivilbevölkerung darstellte – auch ich hielt sie damals dafür –, sehe ich sie jetzt aus der Distanz anders. Ich erkenne, dass es eine Maßnahme zur Aufstandsbekämpfung war mit dem Ziel, den bewaffneten Aufständischen eine potenzielle soziale Basis zu entziehen. Das „Rote Weihnachten“ war weder die erste noch die letzte Menschenrechtsverletzung an der Atlantikküste. Zuvor hatte es schon Auseinandersetzungen, Tote, Folter gegeben, und nach dieser Vertreibung fand das Massaker an Miskitos in Leymus statt, auch dies ein blutiges Mal auf der Akte „Menschenrechte“ der Revolution.
Der Widerspruch, den das revolutionäre Projekt bei seinen Gegnern hervorrief, führte zu Vorfällen, die nicht nur als militärische Repression, sondern auch nach juristischen Kriterien zu verurteilen sind, weil die Regierung ihre Repression mit gesetzlichen Mitteln rechtfertigte. Am 20. Juli 1979 erließ die Regierungsjunta per Dekret das Gesetz zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Dieses Gesetz wurde zu Zeiten angewandt, als im ganzen Land soziale Kontrolle fehlte, da sich nach dem Sturz der Diktatur viele Waffen in den Händen der Bevölkerung befanden. In jenen Tagen wurde getötet aus persönlicher Rache, aus Streit, aus allen möglichen Gründen. Es herrschte einfach Chaos. In dieser Situation wurde das Gesetz erlassen, um für Kontrolle zu sorgen. Danach blieb es allerdings in Kraft und wurde zum Mittel legaler Repression, denn es wurde unterschiedslos von Sondergerichten und von antisomozistischen Volksgerichten angewandt, zwei von der Revolution geschaffenen Instanzen.
Als Oberster Gerichtshof unter Vorsitz von Dr. Roberto Argüello Hurtado waren wir dagegen, dass [Innenminister] Kommandant Tomás Borge diese Sondergerichte und später auch die antisomozistischen Volksgerichte schuf. Wir begründeten das juristisch, denn dadurch wurde die Einheitlichkeit der Rechtsprechung verletzt und die Möglichkeit einer starken und unabhängigen Justiz geschwächt. Zudem wurde den normalen Gerichten die Rechtsprechung über Leute entzogen, die vor ein normales Gericht gehört hätten. Und was antwortete er uns? Dass die normalen Gerichte gar nicht die Kapazitäten hätten, so vielen Leuten den Prozess zu machen. Der wahre Grund war politisches Misstrauen. Man qualifizierte uns als legalistisch ab und betrachtete uns als Reaktionäre.
Sie hörten nicht auf uns. Sie ernannten zur Anklage Sonderstaatsanwälte und zur Verurteilung Sondergerichte, in denen oft nicht einmal ein Rechtsanwalt saß, die in Schnellverfahren urteilten und innerhalb von Stunden über Leben und Tod entschieden … Na ja, Tod nicht, die Todesstrafe war ja abgeschafft. Aber die Leute wurden aus beliebigen Gründen für 20 oder 30 Jahre ins Gefängnis gesteckt. Viele wurden aufgrund der Straftat „kriminelle Vereinigung“ verurteilt, nur weil sie der Nationalgarde angehört hatten. Ich erinnere mich an den Fall eines jungen Mannes, der zwei Wochen vor dem Sieg der Revolution von der Nationalgarde rekrutiert worden war. Ohne in den paar Tagen ein einziges Verbrechen begangen zu haben, landete er wegen krimineller Vereinigung im Gefängnis. Außerdem wurden von diesen Gerichten mehrheitlich nur die einfachen Soldaten verurteilt, denn die höheren Ränge hatten sich ins Ausland abgesetzt. Die Geschichte wiederholte sich: Am härtesten bestraft die Justiz immer die Ärmsten …
Der Missbrauch dieser Gerichte, die nicht einmal die elementarsten juristischen Normen erfüllten, führte zu internationaler Verurteilung und stellte einen hohen politischen Preis für die Revolution dar. Wir im Obersten Gerichtshof mussten viele der Missbrauchs- und Willkürmaßnahmen wieder in Ordnung bringen: Wir setzten Richter ab, versuchten Prozesse für ungültig zu erklären und hoben Urteile auf, zum Beispiel das gegen Oberst Bernardino Larios, den ersten Verteidigungsminister der Revolution. Wir waren die Judikative, aber uns fehlte die Macht, weil das politische Vertrauen in uns fehlte. Ich frage mich oft, ob wir alles taten, was wir konnten, und Widerstand leisteten bis an die Grenzen des Möglichen …
Im Oktober 1981 erließ die Revolutionsregierung das Notstandsgesetz und verhängte zum ersten Mal den Notstand. Dieser wurde von Jahr zu Jahr immer wieder verlängert, sodass wir in der Revolutionszeit praktisch permanent im Notstand lebten. Das Notstandsgesetz bedeutete, dass die Menschen der normalen Gerichtsbarkeit entzogen und vor Sondergerichte gestellt werden konnten. Es bedeutete ebenfalls Zensur der Medien, eine fortgesetzte Verletzung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information. Eine weitere Folge war die Verlängerung der Untersuchungshaft: Man nahm dich fest und du konntest bis zu zwei Jahre in irgendeinem Gefängnis auf deinen Prozess warten. Im Obersten Gerichtshof konnten wir diese Fälle dokumentieren. Diese massive und systematische Menschenrechtsverletzung war eine der schlimmsten und wurde über die ganze Revolutionszeit beibehalten. Juristisch gesehen war beim Notstand einer der gravierendsten Aspekte, dass jede Möglichkeit aufgehoben war, die Habeas-Corpus-Garantien einzuklagen. Die CIDH kritisierte diese Anordnung scharf, denn das Habeas-Corpus-Recht darf unter keinen Umständen aufgehoben werden. Mit der Zeit gab die Revolutionsregierung dem Druck nach und stellte dieses zum Schutz der persönlichen Freiheit unabdingbare Recht wieder her.
Vom Oberstes Gericht aus betrachteten wir auch das sogenannte „Gesetz der Abwesenden“ vom 22. Juli 1981 als repressiv und sprachen uns dagegen aus. Nach diesem Gesetz, das allgemein Antipathie hervorrief, wurden die Güter jeder Person konfisziert, die das Land verließ und nicht innerhalb von sechs Monaten zurückkehrte. Es betraf alle, auch wenn sie keine Verbindung zum Somozismus oder zu irgendeiner bewaffneten oder unbewaffneten Oppositionsgruppe hatten. Wir widersetzten uns auch vehement dem Gesetz über juristische Befugnisse der Polizei, das den normalen Gerichten Funktionen und Zuständigkeiten entzog und auf die Sandinistische Polizei übertrug, die Untersuchungen durchführen und Strafen anwenden konnte. Dieses Gesetz führte zu schweren Missbrauchsfällen.
Während der Revolutionszeit, in der ja auch Krieg herrschte, wurden Menschenrechtsverletzungen auch von anderer Seite begangen. Die Contras – das Heer, das wir später Resistencia (Widerstand) nennen lernten – ermordeten unterschiedslos Bauern, wenn sie den Verdacht hatten, sie unterstützten die Sandinisten, wenn sie sich ihnen nicht anschließen wollten oder sich weigerten, ihnen als soziale Basis zu dienen. Außerdem vergewaltigten sie die Bäuerinnen. Damals musste unsere Landbevölkerung zwischen zwei Fronten leben und wurde von beiden Seiten unterdrückt.
Zu den Gräueltaten der Contra gehörten die Entführungen junger Männer, die ihren Militärdienst im Sandinistischen Heer leisteten. Dies empfinde ich als besonders schmerzhaft für die nicaraguanischen Mütter und denke, dass wir deswegen in ihrer Schuld stehen. Während des Krieges sprachen die in AMFASEDEN (Vereinigung der Mütter von Entführten und Verschwundenen in Nicaragua) organisierten Mütter, die von niemandem unterstützt wurden und mit bloßen Händen arbeiteten, von bis zu 10.000 entführten jungen Leuten. Die Contra hatte sie verschwinden lassen und wahrscheinlich in eins ihrer Lager in Honduras gebracht. Als ich den Obersten Gerichtshof verließ und in die Menschenrechtskommission der Revolutionsregierung versetzt wurde, konnten wir auf Basis der Informationen dieser Mütter fast 900 solcher Fälle mit Namen und Ort der Entführung dokumentieren. Damals waren schon die Friedensvereinbarungen von Sapoá im Gange. Ich erinnere mich, dass ich diese gesamte Dokumentation an eine Person, die an diesen Verhandlungen teilnahm, weitergegeben habe, in der sicheren Erwartung, eine Antwort zu bekommen. Doch ich nahm überhaupt kein Interesse wahr. Der Fall der Contra-Entführungen gehört zu denen, die mich am meisten schmerzen, weil ich ihn aus der Nähe erlebt habe und weil mich die Gleichgültigkeit meiner sandinistischen Genossen schmerzte, die ihm unter dem Druck, den Krieg zu beenden, keine Priorität einräumten.
Die Contra war auch für schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich. Und zu den Verbrechen dieses Krieges muss man auch die von der US-Regierung finanzierten Terrorakte zählen, so die Brandstiftung an den Öltanks in Corinto oder die Attentate der Schnellboote gegen Ziele an den Küsten unseres Landes. Diese Taten wurden im April 1984 vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag verurteilt, in einem Urteil von weit darüber hinausgehender Bedeutung, auch wenn es keine bindende Kraft besaß. Entscheidend ist, dass das Gericht die Regierung der Vereinigten Staaten verurteilte, die ihrerseits damit argumentierte, ihre Beteiligung am Krieg in Nicaragua habe das Ziel, die Menschenrechte der Nicaraguaner zu verteidigen. In der Urteilsbegründung stellt das Gericht fest, dass keine Regierung sich dieses Recht anmaßen darf, sondern dafür die entsprechenden internationalen Instanzen zuständig sind.
Schließlich begann 1990 ein weiterer Übergang. Aus dem Krieg kamen wir in den Frieden; in den ersten Jahren dieses Friedens gab es jedoch zahlreiche schwere Menschenrechtsverletzungen, Verbrechen und Übergriffe, die ungestraft blieben. In diesen Jahren wurden bei uns ständig Morde an ehemaligen Mitgliedern der „Resistencia“ sowie an Bauern und sandinistischen Führungskräften auf dem Land angezeigt. Es gab auch einige besonders symbolträchtige Morde wie der an Arges Sequeira, Mitglied des Landwirtschaftsverbands und der liberalen Partei, und an Enrique Bermúdez, Anführer der „Resistencia“ als „Comandante 3-80. Diese Verbrechen können nicht der Regierung von Doña Violeta angelastet werden, weil sie nicht alle Fäden der Macht in der Hand hielt und weder das Heer noch das Innenministerium kontrollierte. Diese beiden bewaffneten Institutionen standen weiterhin unter dem Befehl der Frente Sandinista und führten das aus, was Daniel Ortega bei der verlorenen Wahl gesagt hatte, nämlich dass man „von unten“ weiterregieren würde.
Ich habe nur einige der vielen Fälle aufgezählt, die offensichtlich belegen, dass in Nicaragua weder die Absicht noch überhaupt die Möglichkeit bestand, dem gerecht zu werden, was wir heute unter Übergangsjustiz verstehen. Betrachten wir nun diesen Begriff, der relativ neu ist und sich heute in Entwicklung befindet, wie alle Fortschritte in der Menschenrechtslehre. Denn Menschenrechte sind nicht statisch, sie entwickeln sich ständig, so wie die Völker und die gesellschaftlichen Bedingungen sich weiterentwickeln.
Die Vorstellung einer Übergangsjustiz entstand – auch wenn der Begriff so noch nicht geprägt wurde – am Ende des Zweiten Weltkriegs, anlässlich der Nürnberger Prozesse, bei denen die Besiegten, die deutschen Nazis, wegen ihrer Verbrechen von den Alliierten vor Gericht gestellt wurden. Von da an entwickelte sich der Begriff. Während des Kalten Kriegs rückte er allerdings in den Hintergrund, und jahrelang sprach praktisch niemand von Übergangsjustiz. Erst 1990, nach dem Fall der Mauer und dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wurde er wieder mit Leben gefüllt, als man Ermittlungen über die Geschehnisse in den Ländern des Ostens begann. Diese Phase fiel zeitlich zusammen mit verschiedenen Demokratisierungsprozessen in Osteuropa, Afrika und Lateinamerika. Und gerade dort, vor allem in Argentinien und Chile, also Ländern, die Militärdiktaturen hinter sich hatten, in denen die Doktrin der nationalen Sicherheit mit eiserner Hand angewandt wurde, erreichte der Begriff der Übergangsjustiz einen Höhepunkt und entfaltete seine Möglichkeiten.
Obwohl der Begriff der Übergangsjustiz noch keine förmliche Grundlage in der Entwicklung des internationalen Rechts der Vereinten Nationen hat, findet er offenbar immer größere Verbreitung. Als ich genauere Informationen für diesen Beitrag suchte, stieß ich auf ein ganz neues Dokument der UNO mit dem Titel „Übergangsjustiz und Verletzung wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte“. Das bedeutet einen Fortschritt, denn Übergangsjustiz war bisher in Bezug auf politische und Bürgerrechte verstanden und angewandt worden: das Recht auf Leben, persönliche Unversehrtheit, ein gerechtes Verfahren, Schutz vor Folter…, also auf die Verletzung aller der Rechte, die von der Somoza-Diktatur, der Revolutionsregierung und der Contra verletzt wurden.
Inzwischen regt die UNO an, die Perspektive zu erweitern und den Begriff der Übergangsjustiz auch dort anzuwenden, wo wirtschaftliche, soziale und kulturelle Recht verletzt werden. Die UNO regt an, für wahre Gerechtigkeit in Übergangsgesellschaften die Ursachen des Konflikts in Betracht zu ziehen, ein Gedanke, der uns im Zusammenhang mit Menschenrechten sehr vertraut ist. Wir wissen ja sehr gut, wie viele Verbrechen, wie viele Akte von Missbrauch und Willkür begangen werden, bloß um eigene Interessen gegen die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte der großen Mehrheit durchzusetzen.
Um den Sinn der Übergangsjustiz besser zu begreifen, müssen wir von einem neuen Rechtsgut ausgehen, dem Recht auf Wahrheit. Es ist nicht in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dem Grundstein für die juristische Entwicklung der Menschenrechte, verzeichnet. Das Recht auf Wahrheit taucht in dieser Erklärung nicht auf, in keinem Vertrag, in keinem internationalen Abkommen, es ist mithin in keinem der formal für Staaten bindenden Dokumente formuliert.
Im Jahr 2005 erkannte die UNO-Vollversammlung das Recht auf Wahrheit zum ersten Mal als Menschenrecht an, als sie die Resolution 66 jenes Jahres verabschiedete, die Argentinien mit Unterstützung von über 50 Ländern aus verschiedenen Regionen der Erde eingebracht hatte. Zum ersten Mal wurde das Recht auf Wahrheit zum Menschenrecht erklärt, auch wenn es nur in einer Resolution steht, die für die Staaten nicht bindend ist. Darin schreibt die UNO das Recht auf Wahrheit als eigenständig fest und definiert es als „das Recht der Opfer schwerer und systematischer Menschenrechtsverletzungen, ebenso wie ihrer Angehörigen und der gesamten Gesellschaft, die Wahrheit über diese Rechtsverletzungen, über die Umstände, unter denen sie begangen wurden, sowie über die Identität der Verantwortlichen zu erfahren“. Diese Resolution setzte die Entwicklung des Rechts auf Wahrheit in Gang, und aufgrund ihrer Bedeutung erklärten die Vereinten Nationen den 24. März zum Internationalen Tag der Wahrheit. Das Datum wurde zu Ehren von Monseñor Óscar Arnulfo Romero gewählt, der [1980] an diesem Tag ermordet wurde.
In der OEA, dem uns am nächsten liegenden Interamerikanischen System, hat das Recht auf Wahrheit ebenfalls Fortschritte gemacht, infolge der Rechtsprechung der CIDH und des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte nach Kenntnis und Untersuchung konkreter Fälle von Menschenrechtsverletzungen. Die CIDH und das Gericht gaben eine entscheidende Erklärung ab: Das Recht auf Wahrheit sei der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte, mithin der höchsten Instanz für Menschenrechte auf dem amerikanischen Kontinent, „wesensmäßig zugehörig und innewohnend“. Ihre Argumentation geht davon aus, dass mehrere Artikel der Vereinbarung verletzt werden, wenn die Wahrheit nicht bekannt wird. Von großer Bedeutung ist auch die Aussage der CIDH, dass Amnestiegesetze, „Schlusspunkt“-Gesetze und Gesetze zum „Gehorsam von Befehlsempfängern“, also alle Gesetze im Sinne von „Schlussstrich und Neubeginn“, das Recht auf Wahrheit verhindern.
Mit dem Recht auf Wahrheit und seiner Entwicklung entstanden die Wahrheitskommissionen als wesentliche Instrumente in einem Prozess der Übergangsjustiz. Wahrheitskommissionen werden erforderlich, wenn die normale Justiz aufgrund irgendwelcher Beschränkungen nicht in der Lage ist, das Recht auf Wahrheit durchzusetzen und die den Opfern von Menschenrechtsverletzungen gebührende Gerechtigkeit walten zu lassen. Durch Wahrheitskommissionen versucht man herauszufinden, was geschah und wie es geschah, wenn die Justizsysteme, die diese Arbeit eigentlich tun müssten, dies nicht können, sich gleichgültig zeigen oder gar Komplizen der Verbrechen sind.
Wahrheitskommissionen haben als ermittelnde Organe die Aufgabe, in Gesellschaften, die Zeiten schwerer politischer Gewalt oder interner Kriege durchgemacht haben, bei der kritischen Aufarbeitung ihrer Vergangenheit zu helfen, damit die durch Menschenrechtsverletzungen verursachten tiefen Krisen und Traumata überwunden werden können. Sie ersetzen die Justiz nicht und ihre Ergebnisse sind im Gegensatz zu juristischen Urteilen für die Staaten nicht bindend. Ist die Justiz wirklich unabhängig, können sie ein zusätzliches und tatsächlich unentbehrliches Hilfsmittel sein. Bis jetzt hat es nach meinen Recherchen in verschiedenen Ländern der Welt etwa 30 Wahrheitskommissionen gegeben, auch wenn nicht alle effektiv gearbeitet haben oder zu einem glücklichen Ende gelangt sind.
Nicht alle Wahrheitskommissionen haben denselben Ursprung. Manche gehen auf eine Regierungsentscheidung zurück, um das Justizsystem zu unterstützen, andere auf Friedensvereinbarungen mit dem Ziel nationaler Versöhnung. Ebenso wenig arbeiten alle mit denselben Methoden, diese hängen ab von den nationalen Realitäten und den verfügbaren Informationen. Ihre Effizienz oder Ineffizienz ist durch den Kontext bedingt. Einige haben nur zur Entschädigung der Opfer geführt, auch eine Form, sie zum Schweigen zu bringen. Und manche haben dazu beigetragen, die Wahrheit zu verschleiern und die offizielle „Wahrheit“ zu legitimieren, so wie die von 1983 in Peru, die unter Vorsitz von Mario Vargas Llosa das Massaker an acht Journalisten und ihrem Führer in dem Andendorf Uchuraccay untersucht hat.
Es gibt zwei Wahrheitskommissionen in nächster Nähe von uns. Eine ist die in El Salvador, die 1992 am Ende des Bürgerkriegs in den Friedensvereinbarungen per Gesetz ins Leben gerufen wurde. Ihr Bericht hieß „Vom Wahnsinn zur Hoffnung: der zwölfjährige Krieg in El Salvador“. Die Ergebnisse wurden am 15. März 1993 veröffentlicht, und fünf Tage später verabschiedete das von der ARENA-Partei beherrschte Parlament ein Amnestiegesetz „zur Konsolidierung des Friedens“, das allen in dem Bericht Genannten eine „umfassende, absolute und bedingungslose Amnestie“ einräumte mit dem Ziel, sie von Verantwortung freizusprechen und jeglichen Anspruch auf Wiedergutmachung, der sich aus dem Bericht ergeben könnte, von vornherein für nichtig zu erklären.
Noch schlimmer kam es in Guatemala. Die Kommission zur Historischen Aufklärung (CEH) war die Wahrheits- und Versöhnungskommission, die Ereignisse aus den dreißig Jahren des internen Konflikts untersuchen sollte. Die Kommission erarbeitete einen Bericht mit dem Titel „Erinnerung an das Schweigen – Guatemala, nie wieder“, der im Februar 1999 vorgestellt wurde. Ein früherer Bericht, „Wiederaneignung der Historischen Erinnerung“ (REMH), ausgearbeitet vom Menschenrechtsbüro des Erzbistums Guatemala, war am 24. April 1998 von Bischof Juan Gerardi, einem bekannten Verteidiger der Menschenrechte, vorgestellt worden. Nur zwei Tage danach wurde Bischof Gerardi brutal ermordet. Die Ergebnisse jener Kommission waren frustrierend. Dennoch kann der Prozess gegen General Ríos Montt von 2013 über seine juristischen Folgen hinaus als symbolischer Akt von Übergangsjustiz gelten, für Guatemala wie für die indigene Ixil-Bevölkerung, die die Gelegenheit bekam, vor einem Gericht die Wahrheit zu sagen und dabei vom ganzen Land gehört zu werden. Der Beharrlichkeit der guatemaltekischen Menschenrechtsorganisationen ist es zu verdanken, dass Ríos Montt auf die Anklagebank kam. Darüber hinaus war der Prozess auch ein Meilenstein in der Geschichte des internationalen Rechts, weil das Gericht einen ehemaligen Staatschef wegen Völkermordes verurteilte.
Wenn es in unseren Nachbarländern Guatemala und El Salvador nach einem internen Krieg Wahrheitskommissionen gegeben hat, warum war dies nicht möglich in Nicaragua, das eine Diktatur und einen internen Krieg hinter sich hatte? Warum hat niemand einen Prozess der Übergangsjustiz in Nicaragua in Betracht gezogen, um den Opfern Gelegenheit zu geben, die Wahrheit zu sagen, sie zu kennen und Wiedergutmachung zu erhalten?
Bei der Analyse der 30 Fälle von Wahrheitskommissionen in verschiedenen Ländern habe ich keine gefunden, die wie in Nicaragua aus dem Übergang einer Diktatur zu einem revolutionären Prozess hervorgegangen war. Bei der Analyse aller Dokumente aus den ersten Jahren der Revolution fand ich heraus, dass niemand je von einer Wahrheitskommission oder dergleichen, sei es auch unter anderem Namen, gesprochen hat. Ich stellte fest, dass die Anführer der Revolution durchaus Gerechtigkeit walten lassen wollten, um die Barbarei der Somoza-Diktatur zu bestrafen, doch das war nur ein Scheingefecht, nur Schau. Eins der ersten Dekrete der Revolutionsregierung beispielsweise war ein Befehl zur Auslieferung Somozas und seiner Familie, die in Miami im Exil lebten, damit sie in Nicaragua für ihre Verbrechen vor Gericht kamen. Aber dieses Dekret war reine Siegesrhetorik und ohne legale Grundlage nicht durchsetzbar. Den Initiatoren fehlte juristische Beratung, die ihnen erklärt hätte, dass eine Auslieferung nicht auf ein einseitiges Dekret eines Landes hin erfolgt, sondern ein bilateraler Vertrag zwischen beiden Ländern bestehen muss. Danach hat nie wieder jemand auch nur versucht, mit der US-Regierung über die Auslieferung Somozas zu reden.
Ich möchte noch auf einen weiteren Sachverhalt hinweisen, bei dem ich nicht weiß, ob er sich in irgendeinem anderen Land ereignet hat. Schon am Tag nach dem Sieg der Revolution, in einer völlig unkontrollierbaren Situation, begann die Revolutionsregierung Begnadigungen auszusprechen. Kommandant Tomás Borge verteilte Begnadigungen wie Bonbons … Er holte aus dem Gefängnis, wen er wollte, er begnadigte jeden, der zu ihm kam und darum bat. Es wurden sehr viele Begnadigungen ohne legale Basis ausgesprochen. Die internationalen Menschenrechtsorganisationen begannen diese Praxis zu kritisieren, denn die Begnadigung löscht die Verantwortung für die begangenen Verbrechen nicht aus. Und sie forderten, dass auf jeden Fall Amnestiegesetze auf legalem Weg erlassen werden sollten.
Auch Amnestien gab es in unseren Übergangsprozessen in großer Zahl, und nicht nur auf internationalen Druck hin. Schon der erste von der Frente Sandinista noch im Exil ausgearbeitete Regierungsplan, der Plan zur Erreichung von Frieden und Stabilität, sah das Versprechen einer Generalamnestie vor. Bei den Vereinbarungen von Sapoá zwischen der Revolutionsregierung und der Contra verpflichtete sich die Regierung zu einer „Generalamnestie“, die so umfassend war, dass sie nicht nur die bewaffneten aufständischen Oppositionellen betraf, sondern „Mitglieder des Heeres des vorausgehenden Regimes“ für Verbrechen von vor der Revolution. Es war eine Amnestie a posteriori für alle Mitglieder von Somozas Nationalgarde. Festgelegt wurde, dass sie „für ihre jeweiligen politisch-militärischen Aktivitäten weder verurteilt noch bestraft oder verfolgt“ würden.
In der Absicht, den internen Krieg zu beenden, enthielt das Regierungsprogramm der UNO mit ihrer Präsidentschaftskandidatin Doña Violeta als einen grundlegenden Punkt das Versprechen einer Generalamnestie für alle, die während des Krieges Verbrechen begangen hatten. Der letzte Bericht der CIDH, in dem ich nachgesehen habe, ist der von 1988, also aus der Zeit, als die Vereinbarungen von Esquipulas schon beschlossen waren und man schon wusste, dass die Wahl vorgezogen würde. Darin wird der Regierung von Nicaragua empfohlen, eine Generalamnestie zu erlassen, es ging sogar so weit, dass ohne diese Amnestie die Wahl von 1990 nicht international anerkannt werden sollte. Das zeigt die politische Richtung der damaligen Kommission unter dem Druck der US-Regierung. Jahre zuvor hatte die Contadora-Gruppe bei ihrem Versuch, dem Krieg Einhalt zu gebieten, die nicaraguanische Regierung auch auf die Notwendigkeit hingewiesen, „legale Normen im Hinblick auf eine wirkliche Amnestie vorzulegen, bestätigen zu lassen, zu erweitern und zu vervollkommnen“. Die Vereinbarungen von Esquipulas legten ebenfalls „Amnestiedekrete“ mit dem Ziel der „nationalen Versöhnung“ fest.
So folgte ein Amnestievorschlag als Ersatz für Justiz auf den anderen, und gleichzeitig wurden unter internationalem Druck ständig Amnestien für Somozisten, Sandinisten und Contras vorgeschlagen, ganz gleich, was für Gräueltaten jede dieser Gruppen begangen hatte. Im Vergleich zu anderen Ländern in Übergangsprozessen beobachten wir in Nicaragua eine Situation sui generis, eine einzigartige Situation, mit ständigen Begnadigungen und ständigen Amnestien. Die Folge war, dass sich ein Zustand völliger Straffreiheit verfestigte. Als die Revolution 1990 schließlich endete, wurde mit der Entwaffnung, dem Ende des Krieges und der Regierungsübernahme Doña Violetas am 23. Mai 1990 ein Amnestiegesetz verabschiedet, das letzte, das wir erlebt haben.
Die neue Regierung versprach, eine Wahrheitskommission einzurichten, doch dieses Vorhaben wurde nie umgesetzt. Stattdessen rief Doña Violeta als Ergebnis des Protokolls zur Überprüfung und Begleitung vom 22. Oktober 1992 die Dreiparteienkommission ins Leben. Dieser Kommission gehörten an: José Pallais, Vize-Außenminister von Nicaragua, Santiago Murray, Vertreter der CIAV-OEA, und Kardinal Miguel Obando y Bravo, der Roberto Rivas als Vertreter ernannte. Aufgabe dieser Kommission war, über die Rechte und Garantien der Demobilisierten der Resistencia“, der Repatriierten und der Familien beider gegnerischer Lager zu wachen. Auf Drängen von CENIDH wurden der Kommission verschiedene Fälle von Menschenrechtsverletzungen an Sandinisten vorgelegt. Die Dreiparteienkommission bewirkte nichts, denn wenn sie ihre Berichte an die Gerichte weitergab, erklärten diese den Fall für „erledigt“ oder die Verantwortung aufgrund des Amnestiedekrets für erloschen.
Hält man sich diese Geschichte und diesen Kontext vor Augen, scheint dann noch eine Wahrheitskommission in Nicaragua möglich? Ich denke, das ist aus vielen Gründen sehr schwierig, weil es keine systematische Dokumentation gab, weder während der Somoza-Diktatur noch während der Revolutionsregierung. Sollte irgendjemand die Absicht haben, eine anzulegen, so glaube ich, dass der CIDH-Bericht von 1978, als die Kommission Nicaragua besuchte, ziemlich viele Daten liefern könnte. Damals gingen etwa 3.500 Anzeigen wegen Menschenrechtsverletzungen durch das Somoza-Regime bei der Kommission ein. Was hat die Kommission mit all diesen Dokumenten gemacht? Ob sie sie aufbewahrt hat? Mit welchen besonders symptomatischen Fällen könnte in Nicaragua eine Wahrheitskommission ihre Arbeit beginnen?
Könnten wir unter den heutigen Umständen, wo weiterhin schwere Menschenrechtsverletzungen begangen werden, die Wahrheit erforschen, könnten wir sie öffentlich aussprechen? Eine Wahrheitskommission – heute, bei einer Justiz, die bekanntermaßen keine Unabhängigkeit besitzt und in der es Beamte gibt, die in gravierende Fälle von Menschenrechtsverletzungen verwickelt sind?
Was würde eine Wahrheitskommission im heutigen Nicaragua nützen? Dass die Opfer die Wahrheit erfahren oder dass ihnen mit Geld der Mund gestopft wird? Denn eine Regierung, wie wir sie jetzt haben, ist gewieft darin, die Leute mit Pfründen zum Schweigen zu bringen. Wenn die Richtung der heutigen Regierung sich nicht ändert, wird es nie die Möglichkeit geben, irgendeine Wahrheit zu erfahren. Und abgesehen von der Position der Regierung, die so sehr die Wahrheit fürchtet, ist die Stimmung in unserer Gesellschaft derart polarisiert, dass eine Wahrheitskommission als ein Ding der Unmöglichkeit erscheint. Es ist schwierig, sehr schwierig. Nicht einmal unter dem bloßen Gesichtspunkt der Verteidigung der Menschenrechte würde ich es wagen, heute eine Wahrheitskommission auf den Weg zu bringen.
Außer diesen Hindernissen, die Nicaragua zu ewiger Straflosigkeit verdammen, gibt es noch eins, das ich in Kolumbien erfahren konnte. Damals verurteilten wir im Ständigen Gericht der Völker, in dem ich Richterin bin, in der Sitzung vom 22. bis 25. April 1991 die Straflosigkeit der Verbrechen gegen die Menschheit, welche die Militärdiktaturen Lateinamerikas begangen hatten. Es wurde das verurteilt, was sich in allen Ländern des Kontinents ereignet hatte, die unter Diktaturen gelitten hatten – außer den Ereignissen in Nicaragua. Warum? Weil die Menschenrechtsorganisationen in manchen Punkten mit der Linken übereinstimmten und besonders auf die Fälle aus der Somoza-Diktatur hinwiesen, um nicht zu dem zu stehen, was unter der Revolutionsregierung geschehen war. In dieser Sitzung war Alejandro Bendaña, während der Revolutionsregierung Staatssekretär im nicaraguanischen Außenministerium, als Experte eingeladen. Er verwies in aller Deutlichkeit auf das Hindernis: Was soll bei der Entwicklung der Übergangsjustiz oder der Einrichtung einer Wahrheitskommission Vorrang haben: die Wahrheit oder der Frieden? Was soll man höher bewerten: das Recht der Opfer auf Wahrheit oder das Recht der Gesellschaften und Nationen auf Frieden? Dieser Widerspruch besteht und es gibt eine Diskussion über dieses Dilemma. Von diesem Widerspruch aus muss man analysieren und verstehen, was Nicaragua erlebt hat.
Auch wenn Wahrheitskommissionen einen relativen Wert haben, auch wenn sie nicht die normale Justiz ersetzen, auch wenn sie nicht bindend sind und die Staaten nicht verpflichten, sind sie ein wichtiger Beitrag, wenn Untersuchungen aufgrund fehlenden politischen Willens, technischer Unfähigkeit oder sonstiger Einschränkungen unzureichend sind und an Grenzen stoßen. In diesen Fällen sind Wahrheitskommissionen die Stimme der Menschen, die Grausamkeiten und Unheil am eigenen Leib erfahren oder miterlebt haben und das nicht vergessen können.

Auch wenn ich es vielleicht nicht sehen will, auch wenn ich die Wahrheit über so viel Unheil, das in Nicaragua erlitten wurde, nicht hören will, muss man doch darauf vertrauen, dass die Wahrheit eines Tages ans Licht kommt. Wir haben die Pflicht, weiter für die Bedingungen zu kämpfen, die der Wahrheit zum Durchbruch verhelfen. Wir dürfen nicht müde werden, auf dem Recht auf Wahrheit zu bestehen, einem Recht, das nicht verjähren kann, selbst wenn Jahrzehnte vergangen sein sollten.
Viele in Nicaragua haben das Recht auf Wahrheit, auf Gerechtigkeit und auf Wiedergutmachung. Wir haben die Pflicht, uns weiterhin dafür einzusetzen, dass dieser Tag kommt, um die Schuld abzulösen, die wir gegenüber so vielen Opfern haben. Diejenigen, die so viele Grausamkeiten überlebt haben, haben ausgehalten, doch sie sind nicht geheilt. Und die Wahrheit zu erfahren, sie auszusprechen, sie zu kennen, sie zu hören, ihr Gehör zu verschaffen, ist immer ein erster Schritt zur Heilung. Nicaragua ist es den Opfern immer noch schuldig.