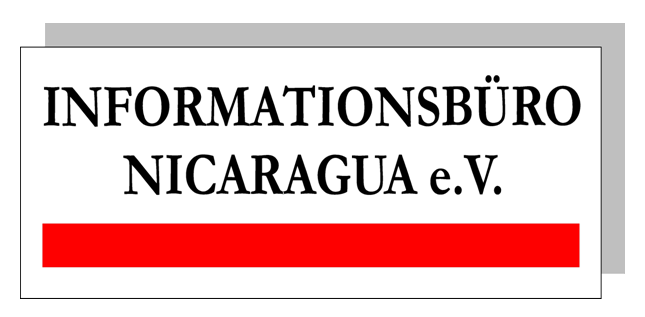von Klaus Hess und Barbara Lucas 21.11.1995
Die bundesdeutsche Solidaritätsbewegung mit Nicaragua begann 1978, ein Jahr vor dem Sturz der Somozadiktatur und dem Sieg der Sandinisten und dauert bis heute an. Somit ist sie die längste und größte internationalistische Bewegung in der Nachkriegszeit und kann inzwischen auf eine fast 30jährige eigene Geschichte zurückblicken. Auch in der DDR gab es vielfältige Solidaritätsaktivitäten mit Nicaragua, sowohl von staatlicher Seite wie aber auch von kirchlichen und unabhängigen Gruppen.
Wir, die Autoren dieses Kapitels, waren von Anfang an in der Solidaritätsbewegung aktiv und arbeiteten später und bis heute im Informationsbüro Nicaragua in Wuppertal. Klaus beteiligte sich in Bonn 1978 zum ersten Mal an einer Demonstration gegen die Somozadiktatur und für den Abbruch aller diplomatischen Beziehungen. Im Frühjahr 1979 versuchten dann die ersten Solidaritätskomitees an Sandinos Todestag zeitgleich verschiedene nicaraguanische Botschaften in Europa zu besetzen. Diese Aktion, die in Bonn leider von der Polizei verhindert wurde, war Teil der ersten koordinierten Aktion der Solidaritätsgruppen auf europäischer Ebene, angeregt vom damaligen Europavertreter der FSLN, Enrique Schmidt- Cuadra. . Enrique hatte Anfang der 70er Jahre in Köln studiert, war danach nach Nicaragua zurückgegangen, wurde dort jedoch verhaftet und gefoltert und kam nach Deutschland zurück, um die Solidaritätsbewegung mit den Sandinisten aufzubauen. Auf seine Initiative hin wurde 1978 in Wuppertal das Informationsbüro Nicaragua unter Mitwirkung von Hermann Schulz und Mitarbeitern des Peter Hammer Verlags gegründet. Barbara stieß 1981 zum Infobüro, das damals noch aus zwei Schreibtischen hinter den Bücherregalen des Dritte Welt Buchladens bestand, wo täglich Telexe aus Managua eingingen und die Nicaragua-Nachrichten als authentische Information zusammengestellt und verschickt wurde.
Wir schreiben also nicht von Außen über die Solidaritätsbewegung, sondern über unsere eigene Geschichte. Oft genug waren wir selbst am Entwurf der dargestellten Plakate beteiligt bzw. haben die entsprechenden Aktionen oder Kampagnen mit diskutiert. Der Rückblick- und der erneute Anblick der Plakate, die meist jahrelang in Archiven verschwunden waren- löst also bei uns die unterschiedlichsten Gefühle und Erinnerungen aus, angefangen von der Wehmut und der nostalgischen Erinnerung an die Aufbruchstimmung und den Enthusiasmus dieser Jahre über das Erstaunen über manche Symbolik bis hin zum Kopfschütteln oder gar Entsetzen.
Mit diesem Beitrag wollen wir die Aktivitäten der Solidaritätsbewegung noch einmal im Überblick darstellen, wir wollen versuchen, die Aufbruchstimmung der 80er Jahre zu vermitteln, und darlegen, welche Träume und Hoffnungen uns antrieben und uns Kraft gaben. Wir wollen die theoretischen und politischen Grundannahmen unseres Handelns aus heutiger Sicht kritisch kommentieren. Und nicht zuletzt wollen wir aufzeigen, in welchem Rahmen und mit welchen Partnern und Schwerpunkten Nicaraguasolidarität auch heute noch als Teil des Widerstandes gegen die Globalisierung fortgeführt wird.
Wir tun dies zum einen als Versuch, jüngeren Menschen in internationalistischen Gruppen unsere Erfahrungen mitzuteilen und in einen intergenerationellen Dialog zu treten. Zum anderen treten wir damit aber auch in einen erneuten Diskussionsprozess mit denen ein, die gemeinsam mit uns damals ( und heute) in der Solidaritätsbewegung aktiv waren oder in Nicaragua die Revolution miterkämpft und mitgestaltet haben, wie die meisten der Autoren in diesem Band.
Die Anfänge der Solidarität und unsere Grundannahmen
Bis zum Sieg über die Somozadiktatur am 19.Juli 1979 war die Nicaragua-Solidaritätsbewegung eher klein, erst nach der Machtübernahme der Sandinisten wuchs die Bewegung auf zeitweilig über 350 örtliche Solidaritätskomitees an, größtenteils unabhängige Komitees, zum Teil Gruppen aus dem kirchlichen und gewerkschaftlichen Bereich und in späteren Jahren zunehmend auch Städtepartnerschaftsvereine. Dieses Anwachsen nach der Machtübernahme einer Befreiungsbewegung unterscheidet sie von anderen Solidaritätsbewegungen mit Befreiungsbewegungen wie etwa mit der MPLA in Angola, der ZANU und ZAPU in Zimbabwe oder der FNL in Vietnam. Hier war die Solidarität zu Zeiten ihres Kampfes für die Unabhängigkeit am größten. Ende der 60ger und Anfang der 70er Jahre wurden Bilder von Ho Tschi Minh und Che Guevara in Europa auf den Demos gegen den Kolonialismus und Imperialismus getragen. Die Älteren unter uns hatten noch gegen die Militärdiktaturen in Griechenland, Spanien und Portugal protestiert, Frantz Fanon gelesen und waren auf die Strasse gegangen, als Pinochet am 11.September 1973 mit Hilfe des CIA in Chile die Regierung von Salvador Allende blutig stürzte und Tausende von Linken ermorden ließ. Die Tupamaros in Uruguay waren eine Hoffnung für uns gewesen und der bewaffnete Kampf im Trikont, in der Dritten Welt oder wie immer wir den Süden nannten, erschien uns die einzig mögliche Antwort der Unterdrückten.
Bewaffnete Befreiungsbewegungen wie die FSLN waren Hoffnungsträger auf eine gerechte Zukunft. Zentraler Ansatzpunkt für eine tiefgreifende gesellschaftliche Veränderung war für uns die Eroberung der Staatsmacht und die Erlangung der nationalen Souveränität durch die Vertreibung Somozas, der lediglich als Marionette der USA und des Imperialismus betrachtet wurde. Sicherlich gab es unterschiedliche Vorstellungen darüber, ob die notwendigen Veränderungen eher schneller, radikaler und revolutionärer oder behutsamer, langsamer und eher reformerisch umgesetzt werden sollten, paradigmatische Grundlage unseres Denkens war es jedoch, dass mit der Eroberung der Staatsmacht durch die bewaffnete Befreiungsbewegung die Vorausetzung für die gesellschaftliche Umwälzung gegeben war, „vor uns die Mühen der Ebene“ wie es auf einem Plakat hieß.
Und mit dem erfolgreichen Volksaufstand nach dem Konzept der Terceristas, dem Zusammenschluß der drei Tendenzen der FSLN zu einer Bewegung, dem breiten Bündnis auch mit bürgerlichen Kräften in der ersten Regierung, dem mit neun Comandantes besetzten kollektiven Führungsgremium der Sandinisten und den ersten Maßnahmen der Revolutionsregierung, wie etwa die Abschaffung der Todesstrafe, die Durchführungder Alphabetisierungskampagne oder die Ankündigung der Agrarreform schienen die verloren geglaubten Träume der 70er Jahre nun endlich in Erfüllung gehen zu können.
Gerade für den Teil der Linken, der Zweifel und Kritik an den Entwicklungen im sogenannten realen Sozialismus hatte und deutlich die Grenzen jedweder emanzipatorischer Entwicklungen dort sah, erschien Nicaragua als ein neuer Weg, mit einem auf Mischwirtschaft ausgerichteten Wirtschaftskonzept, einem breiten politischen Bündnis und einer demokratischen Auseinandersetzungskultur mit unterschiedlichen Parteien, vor allem aber Gewerkschaften, Verbänden und Massenorganisationen.
Eine der Symbolfiguren in der BRD war zudem Ernesto Cardenal, Priester und Poet, der schon 1973 eine erste Lesereise durch Deutschland gemacht hatte und mit seinen Gedichten und seiner befreiungstheologischen Botschaft viele Menschen im kirchlichen Umfeld begeistert hatte und eine ganze Reihe von Kontakten im Kulturbereich geschaffen hatte. Er wurde später Mitglied der „Gruppe der Zwölf“, die von Costa Rica aus die Sandinisten unterstützte, und nach dem Sieg wurde er zum Kulturminister ernannt.
Auch die Ernennung seines Bruders Fernando Cardenal zum Erziehungsminister und eines weiteren Priesters, Miguel d`Escoto, zum Außenminister sowie die Einbeziehung von bekannten Frauen wie etwa Dora Maria Tellez, damals bekannt als Comandante Dos einer gelungenen Guerillaaktion, vermittelte nach Außen das Bild großer Diversität.
Die Revolution in Nicaragua schuf über viele Jahre hinweg eine neue Ethik der Solidarität, nicht nur in der BRD, sondern in ganz Europa, den USA und Lateinamerika. Die Parole „Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker“ begleitete unzählige Veranstaltungen, Aktionen und Geldsammlungen für Solidaritätsprojekte und war der inhaltliche Rahmen für die schätzungsweise 15.000 Deutschen, die im Laufe der 10 Jahre sandinistischer Revolutionsregierung zu mehr oder weniger langen Aufenthalten nach Nicaragua aufbrachen.
Die Revolution in Nicaragua war eine gemeinsam geteilte Utopie. In Nicaragua selbst mobilisierte sie eine ganze Generation, die mit Pflastersteinen, selbstgebauten Bomben und Molotowcocktails die Nationalgarde Somozas angriff und nach dem Sieg in der großangelegten Alphabetiserungskampagne enthusiastisch in die Dörfer ging, um mit den Campesinos zu leben und ihnen lesen und schreiben beizubringen. Außerhalb von Nicaragua mobilisierte sie eine Generation von Menschen, die sich solidarisch zeigten auf 1000 verschiedene Arten, nicht zuletzt durch einen Aufenthalt in Nicaragua, der in den meisten Fällen das Leben dieser Menschen nachhaltig prägte und veränderte. Vergleichen lässt sich diese Mobilisierung höchstens mit der Solidarität, die die Verteidigung der Republik in den Jahren des spanischen Bürgerkrieges hervorrief.
Schon bald jedoch begannen die Angriffe der von den USA finanzierten Contras und die gezielte Desinformation in den Medien. Anders als heute in Zeiten des Internet, war die direkte Kommunikation nach Nicaragua schwierig und so lag eine der Hauptaufgaben der Solidaritätsbewegung darin, authentische Informationen zu vermitteln. Darüberhinaus wurden Spendensammlungen organisiert und Protestaktionen gegen die drohende Invasion der USA und die zunehmende versteckte Kriegsführung von Seiten der Contras. Gemeinsam mit der El Salvador- und Guatemala-Solidaritätsbewegung führten wir eine Antiinterventionskampagne durch, deren Höhepunkt ein Kongress in Münster mit der Beteiligung von 1700 Menschen war. Zudem wurden lokale und bundesweite Bündnisse mit der Friedensbewegung geschaffen und wir arbeiteten im Koordinierungsausschuß der Friedensbewegung mit, um auf den Zusammenhang zwischen der Raketenstationierung und den mehr oder weniger offen geführten Kriegen im Trikont hinzuweisen.
Die Brigadenkampagne
Ab 1982 nahmen die Contra-Angriffe vor allem aus Honduras erheblich zu. Angegriffen wurden alle neu geschaffenen sozialen Einrichtungen wie Schulen oder Agrarkooperativen.
Jede Maßnahme der Regierung wurde auf dem Hintergrund des damals herrschenden Kalten Krieges interpretiert, die Unterstützung der USA für die Contra als Hilfe für Freiheitskämpfer betitelt und die Sandinisten als Kommunisten beschimpft, die der sowjetischen Einflussnahme in Mittelamerika Tür und Tor öffneten.
Angesichts dieser Bedrohung des Aufbauprozesses wuchs die Solidaritätsbewegung stark an und es entstanden viele neue Gruppen bis weit in die Sozialdemokratie hinein. Die damalige christdemokratische Bundesregierung unterstützte die US-Außenpolitik und hatte die Entwicklungshilfe für Nicaragua gestoppt. Später konnten wir nachweisen, dass die Contra und ihr ziviler Arm über verschiedene deutsche Vereine und politische Stiftungen mitfinanziert und politisch unterstützt wurde.
1983 wurde der Freiburger Arzt Tonio Pflaum im Norden Nicaraguas zusammen mit nicaraguanischen Krankenschwestern von einer Contragruppe aus einem Bus gezerrt und kaltblütig ermordet. Tonio Pflaum war 1980 mit dem staatlichen Deutschen Entwicklungsdienst nach Wiwili gegangen, um dort das Gesundheitswesen aufzubauen. Kurz nach seiner Ermordung wurden alle offiziellen Entwicklungshelfer aus den umkämpften Gebieten zurückgezogen.
Als die USA dann 1984 auf der Karibikinsel Grenada einmarschierten, um die dortige linksgerichtete Regierung zu beseitigen, schien es nur noch eine Frage der Zeit bis sie auch in Nicaragua einmarschieren würden. In dieser Situation rief die FSLN zur Bildung von internationalen Brigaden auf, die zunächst in der Kaffeeernte helfen sollten, später als sogenannte Aufbauhelfer beim Wiederaufbau von Schulen oder Krankenhäusern eingesetzt wurden. Innerhalb kürzester Zeit reisten die ersten Gruppen von US-Bürgern und von Europäern nach Nicaragua, um dort in den von der Contra bedrohten Gebieten als „menschliche Schutzschilde“ zu arbeiten. Die deutsche Solidaritätsbewegung charterte ein Flugzeug von Air Cubana und innerhalb von 4 Wochen fanden sich 150 Brigadisten und Brigadistinnen, die begleitet von Journalisten und Prominenten wie dem damaligen Bremer Sozialsenator Henning Scherf, nach Nicaragua in die Kaffeeernte flogen.
Dieser Kampagne lag die Einschätzung zugrunde, dass die USA es sich kaum leisten könnten, eigene und europäische Bürger bei einer Invasion zu töten. Die Brigadisten sollten zudem auch die bedrohten Dörfer durch ihre Anwesenheit gegen Contraangriffe schützen helfen und das wiederaufbauen, was die Contra zerstört hatte. In der BRD wurde der praktische Arbeitseinsatz in Nicaragua mit dem Protest gegen US-Einrichtungen, die Komplizenschaft der Bundesregierung und rechtsgerichtete Contra-Unterstützer verbunden.
Im Rahmen der Brigadenkampagne kamen nach Schätzungen insgesamt ca 15.000 Menschen zu längeren oder kürzeren Aufenthalten nach Nicaragua. Nach ihrer Rückkehr wirkten sie als Multiplikatoren, berichteten über ihre Erfahrungen und schoben vielerorts neue Projekte an.
Viele der Brigadisten waren emotional tief beeindruckt von dieser Erfahrung, hatten am eigenen Körper oft zum ersten Mal Armut und Hunger erfahren, hatten ihre Angst bewältigt und ihr Leben eingesetzt zur Verteidigung eines Projekts einer gerechteren Zukunft. Dies stand oft im krassen Gegensatz zu den Ohnmachtserfahrungen und Entfremdungserlebnissen im eigenen Land. In Nicaragua fühlte man/frau sich gebraucht, es ging um etwas, die Positionierung war einfach, die Brigadisten waren mit dem Herzen dabei und es gab Gestaltungsmacht. Die Stimmung des sichtbaren kollektiven „vamos haciendo la historia“ hat viele von uns nachhaltig beeinflußt.
Die Auswirkungen des Erlebten hat die Brigadisten fast alle nachhaltig geprägt hat. Vereinzelt finden heute Jubiläumstreffen einzelner Brigadegruppen statt, Brigadisten reisen heute noch einmal dorthin auf den Spuren ihres damaligen Wirkens, andere zeigen ihren Kindern die Orte ihres Einsatzes und viele sind ganz einfach für Jahre oder gar bis heute da geblieben.
Einige europäische und us-amerikanische Freiwillige wurden von der Contra ermordet. Eine gesamte bundesdeutsche Brigade wurde für drei Wochen von der Contra entführt. In Freiburg erinnert noch heute eine kleine Brücke an die beiden im Norden Nicaraguas ermordeten Freiburger Tonio Pflaum und Bernd Koberstein. Viele, vor allem junge Menschen riskierten ihr Leben, um damit ein Stück sozialrevolutionärer Utopie voran zu bringen.
Das bedeutete aber natürlich zugleich eine Funktionalisierung Nicaraguas und der Nicaraguaner als Projektionsfeld für eigene Ideale und unerreichbare Ziele in der eigenen Gesellschaft. Dabei werden und wurden oft eigene Entwicklungsvorstellungen auf Nicaragua übertragen. So etwa von der Kaffeebrigade, die – selbst alles Städter – neben der Küche einen diversifizierten Gemüsegarten für NicaraguanerInnen anlegten, was diese interessiert beobachteten. Am nächsten Tag liefen die Kühe darüber. Oder die Häuserbrigade, die nach eigenen Vorstellungen ein Wasserpumpsystem errichtet hatte, damit die Leute in Pantasma den Weg zum Wasserholen verkürzen konnten. Allerdings gab es keinen regelmäßigen Treibstoff, Ersatzteile sowieso nicht. Oder die gutgemeinten Latrinen neben den Häusern, die leider überhaupt nicht den kulturellen Gewohnheiten der Menschen auf dem Land entsprachen. Solche paternalistischen Auswüchse, die von der Annahme der eigenen überlegenen Kompetenz ausgingen, wurden später durchaus thematisiert und immer mehr abgelegt.
Bedenklich waren auch die Selbstdarstellungen der Brigaden und die Darstellung ihres eigenen Landes. Die Brigadisten brachten vor allem Fotos vom Waldsterben, Müllbergen, Atomkraftwerken und Hochhäusern mit nach Nicaragua und vermitteln so zwar sicherlich ihre Kritik an der BRD nicht aber ein vielschichtiges Bild des Landes. Was mögen wohl Nicaraguaner von solchen Darstellungen gehalten haben? Aus später durchgeführten Interviews geht zumindest hervor, dass viele Nicaraguaner die Brigadisten nicht als Oppositonelle im eigenen Land wahrgenommen haben, sondern stattdessen nur schwer zwischen staatlicher Entwicklungshilfe und solidarischem Brigadeneinsatz unterscheiden konnten.
Neben der Brigadenkampagne wurden immer auch andere Kampagnen initiert, die auf die direkte Veränderung im Norden abzielten, etwa die Aktionen gegen den Weltwirtschaftsgipfel in München oder die Anti-IWF Kampagne. Ähnliche Ansätze lagen in den Kaffeekampagnen zur Begründung des fairen Handels. Hierbei sollte am Beispiel des Kaffees und seines Imports zu höheren Preisen auf die ausbeuterischen Bedingungen des Weltmarkts aufmerksam gemacht werden und auf die Erlangung fairer Preise hingearbeitet werden. Grundverständnis in der Solidaritätsbewegung war, dass Solidarität mit Nicaragua verbunden werden müsse mit dem Kampf für strukturelle Veränderungen bei uns im Norden und einer Veränderung der eigenen Lebens-und Konsumgewohnheiten.
Die Strukturen der Bewegung und das Konzept der „kritischen Solidarität“
Schon bald nach der Regierungsübernahme der Sandinisten wurde deutlich, dass es notwendig sein würde unsere Position gegenüber der FSLN zu definieren. Die FSLN war nun eine Befreiungsbewegung an der Macht, entwickelte sich später zudem zur Partei, und wir waren eine Solidaritätsbewegung mit multipolarer Zusammensetzung und basisdemokratischen Strukturen, mehr ein Netzwerk denn eine feste Organisation. Zweimal im Jahr gab es Bundestreffen, auf denen inhaltliche Fragen diskutiert und zentrale Kampagnen verabschiedet wurden. Das Informationsbüro Nicaragua war eine eigene kollektive Struktur, die sich zunehmend professionalisierte und die örtlichen Komitees koordinierte, politisch durch die Bundestreffen legitimiert, aber häufig auch wegen mangelnder Anbindung kritisiert. Gegenüber der FSLN waren wir ein zentraler Ansprechpartner für die unabhängige Solidaritätsbewegung. Auf Seiten der FSLN war das Departamento de Relaciones Internacionales (DRI) für die politischen Kontakte zuständig, für Projektgespräche in den ersten Jahren oft auch direkt einzelne Ministerien, später Projektpartner in den Regionen, Gewerkschaften oder lokale Gruppen und Institutionen.
Als Grundkonzept für unsere Solidaritätsarbeit diente das Konzept der „kritischen Solidarität“. Auf gar keinen Fall sahen wir uns als ein verlängerter Arm der FSLN oder eine Freundschaftsgesellschaft. Vielmehr verstanden wir uns als bundesdeutsche politische Kraft, mit eigenen politischen Positionen, die im Bereich des Internationalismus aktiv war. Wir wollten die Revolution solidarisch unterstützen und zugleich die Strukturen im eigenen Land verändern.
„Kritische Solidarität“ bedeutete für uns mit den grundsätzlichen Zielen der FSLN solidarisch zu sein, uns mit den Bedingungen und Begründungen ihres Handelns auseinanderzusetzen, sie aber nicht unbedingt zu billigen. Wir sahen es als unsere Aufgabe an, parteilich aber kritisch über die Revolution zu informieren und sie zu unterstützen.
Aus heutiger Sicht muß jedoch auch angemerkt werden, dass wir dem Dialog mit den offiziellen Strukturen der FSLN nicht allzu große Bedeutung beimaßen bzw. die Termine mit dem DRI recht schnell als eher technische Termine verstanden. Die FSLN suchte umgekehrt auch nicht gerade den inhaltlichen Dialog mit uns, sondern beschränkte die Kommunikation weitgehend darauf, uns Solidaritätskampagnen vorzuschlagen.
Wir entwickelten unsere Positionen aus unserem Verständnis von Antiimperialismus heraus und waren selbst zögerlich darin, NicaraguanerInnen und LateinamerikanerInnen im Infobüro mitarbeiten zu lassen. Mit den Jahren wurden auch die Zweifel daran stärker, dass wir gemeinsame Ziele mit der Führung der FSLN teilten. Und als Daniel Ortega eines Abends mehr aus Zufall mit einigen von uns, die wir damals in einem Kommuneprojekt wohnten, über Ideale und Utopien sprach, verdichteten sich diese Zweifel zu unangenehmer Sicherheit.
Gemäß unserer Vorstellung der kritischen Solidarität veröffentlichten wir die Zeitschrift Envio und eine Reihe von Büchern mit eigenen Analysen. Schon sehr bald kam es vor allem in der Frage der Politik gegenüber den Indigenas an der Atlantikküste und dem Emanzipationsverständnis der sandinistischen Frauenorganisation AMNLAE zu größeren Differenzen. Das bedeutete zum einen, dass wir uns auch öffentlich kritisch äußerten, zudem aber auch im weiteren Verlauf eigene Ansprechpartner in diesen Bereichen suchten. An der Atlantikküste stieß dies auf erhebliche Probleme; eine Delegation der Solidaritätsbewegung konnte nur in Begleitung von Militärs bzw FSLN Kadern reisen und zum Teil wurden wir gar vom Geheimdienst beobachtet und an Kontakten gehindert.
Was die Kontakte zu Frauengruppen anging, so entwickelten wir schnell gute Beziehungen zu unabhängigen und feministischen Sandinistinnen, mit denen wir in der Kritik am Machismo innerhalb der Frente übereinstimmten und sie darin unterstützen, ihre Forderungen nach Emanzipation auch in Zeiten äußerer Bedrohung zu formulieren.
Mit der Zuspitzung des Krieges wurden auch die demokratischen Möglichkeiten in Nicaragua selbst immer mehr eingeschränkt und die Debatte innerhalb der Frente eingeengt. Die kollektive Führungsspitze wurde zunehmend vom Caudillo Daniel Ortega überragt und die in Nicaragua durchaus beliebte Parole „Dirección Nacional ordéne!“ (Nationale Führung befiehl!) ließ uns eher das Blut in den Adern gefrieren.
Dennoch war die Diskussion um Nicaragua – zumindest nach Außen von einem starken Druck zur Geschlossenheit geprägt. Jede kritische Anmerkung wurde schnell zum Argument für die Seite der Intervention und im Klima des Kalten Krieges vereinnahmt. Deshalb wurde Kritik an der FSLN bis zu ihrer Wahlniederlage 1990 nur selten offen formuliert. Eher suchten wir andere Gesprächs- und Projektpartner, ausgehend von der Analyse, dass die Revolutionsregierung ihrerseits den Druck unabhhängiger sozialer Bewegungen brauchte und Verbindungen zu Basisgruppen auch eher unserem Ansatz von sozialer Emanzipation entsprach. So entwickelten wir schon vor der Wahlniederlage gute Beziehungen zu feministischen Basisgruppen wie dem Colectivo de Mujeres in Matagalpa und anderen Frauenprojekten. Diese Frauengruppen erschütterten auch unser bis dahin durchweg positives Verhältnis zur revolutionären Gewalt, indem sie aufzeigten, dass die Zunahme von innerfamiliärer Gewalt in direktem Zusammenhang mit dem Krieg stand.
Auch zum Kongress „10 Jahre Revolution in Nicaragua“ luden wir eher zwar parteiliche aber nicht in die Partei eingebundene Experten ein, um gerade auch über das Spannungsfeld von Regierungspolitik und Basisforderungen diskutieren zu können.
Gerade hier zeigte zum Beispiel die Debatte über die nur schleppend vorankommende Vergabe von individuellen Landtiteln in den Grenzregionen und die massive Umsiedlung von Bauern in den Kriegsgebieten, dass es durchaus einen Zusammenhang gab zwischen Fehlern und Versäumnissen der Revolutionsregierung und der Zunahme des Krieges.
Die Plakate der Solidaritätsbewegung in den 80er Jahren und die Rolle der Gewehre
Da die Bewegung in den 80er Jahren sehr breit und vielfältig war, ist auch ihr visueller Ausdruck sehr breit gefächert.
Als positive Symbole des revolutionären Aufbaus überwiegen lachende Kinder, freundliche Campesinos und Frauen. Dies unterscheidet diese Plakate von anderen „Dritte-Welt-Plakaten“, in denen eher das Elend und die Ausbeutung in den Vordergrund rückt. Die NicaraguanerInnen wurden als handelnde Subjekte abgebildet, wenn auch oft romantisch verklärt.
Ein anderes oft verwendetes Symbol sind die geöffneten Hände voller Erde mit Kaffeesetzlingen, die unser erstes logo waren und später auch die Packungen fair gehandelten Kaffees zierten.
Ansonsten überwiegen die Farben rot und schwarz, Symbolfarben sowohl der FSLN wie auch der salvadorianischen FMLN, aber natürlich auch die Traditionsfarben sozialistischer und anarchistischer Bewegungen und Parteien. Sie finden sich als Hintergrund oder auch als Fahne auf der Mehrheit der Plakate.
Hohen Symbolgehalt hatte neben der Fahne auch das Gewehr, sei es in der Hand junger Guerilleros, in der Hand von Frauen oder in stilisierter Form. Das entspricht dem positiven Mythos der revolutionären Gewalt und des bewaffneten Kampfes, der die Bewegung der 80er Jahre auszeichnete. Die Unterstützung des bewaffneten Kampfes war gleichbedeutend mit Radikalität. Auf manchen Bundestreffen debattierten wir, dass wir stärker die Verbindung zwischen dem Aufbau in Nicaragua und dem bewaffneten Kampf in Salvador herstellen müssten, da nur dies radikal sei. Die Frage des bewaffneten Kampfes war angeblich die Unterscheidungslinie zwischen Radikalen und Reformern. Dies bedeutete natürlich auch eine Abwertung anderer Aktionsformen. So wurden beispielsweise die konsequent gewaltfreien Brigadeneinsätze us-amerikanischer christlicher Gruppen belächelt, während viele Brigadisten gleichzeitig voller Stolz über ihre Teilnahme an bewaffneten Nachtwachen berichteten.
Die Verklärung der Gewalt in der Solidaritätsbewegung traf sich mit einer Art Totenkult und einer Ethik des Opferbringens in Nicaragua. Dort wurden die gefallenen Guerilleros bei Veranstaltungen namentlich aufgerufen und mit dem Ruf „Presente!Presente!Presente!“ (Hier unter uns) begrüßt. Sie waren die wirklichen Helden, sie hatten ihr Leben für die Gemeinschaft gegeben. Diese Ethik des Opferbringens durchzog den Alltag in Nicaragua viele Jahre. Helden waren diejenigen, die sich selbst verneinten und alles für das Ziel der Revolution gaben. Die Lebenden waren dazu verpflichtet, in ihrem Verhalten den Toten nachzueifern. Alles andere galt als Schwäche oder gar Verrat.
So ist es auch nicht verwunderlich, dass entsprechende Themen tabuisiert wurden. Tabu waren etwa die Auswirkungen der Gewalt und des Krieges auf die sandinistischen Soldaten. Ende der 80ger Jahre berichteten Frauengruppen von Vergewaltigungen in Beziehungen und Gewaltanwendung von Seiten sandinistischer Soldaten auf Heimaturlaub ohne dass dies Thema aufgegriffen wurde. Auch in der Solidaritätsbewegung wurden die entführten Brigadisten, die mehrere Wochen in der Hand der Contra waren und mit dem Tode bedroht wurden, nicht genauer nach ihren Erfahrungen gefragt, geschweige denn fragte jemand nach möglichen Traumatisierungen.
So muß man sagen, dass unser mythisches Verhältnis zur Gewalt und zum Heldentum auch mit dazu beigetragen hat, uns die Augen vor der Kriegsmüdigkeit der Nicaraguaner zu verschließen. Wir wollten nur Helden sehen und übersahen dabei die Heterogenität der Bevölkerung. Auch die Frage, ob vielleicht Revolutionäre bisweilen eine Art Reproduktionsphase brauchen, war viele Jahre Tabu.
Die Neubestimmung der Solidarität zur Jahrhundertwende
Die Wahlniederlage der Sandinisten, der Machtwechsel in Nicaragua und die Epochenwende im Ostblock leiteten eine Desillusionierung in der Solidaritätsbewegung und Neubestimmung des Internationalismus ein. Die privaten Bereicherung führender Partei- oder Gewerkschaftsfunktionäre und der Umgang der FSLN mit Dissidenten beschleunigte notwendige Erkenntnisprozesse
1. Unser Traum von klaren Perspektiven wie „Solidarität mit einem Land“ oder Bezug auf das Avantgardekonzept einer wie auch immer gearteten Partei war ausgeträumt, nicht nur in Nicaragua. Die kapitalistische Globalisierung, die für viele nur die systematische Verarmung, sozialen und wirtschaftlichen Ausschluss und die Zurichtung für einen anonymen Markt bereithält, begann scheinbar alternativlos voran zu schreiten. Heute verstehen wir uns weder als Nachlaßverwalter der Solidaritätsbewegung noch als Archivare der sandinistischen Revolution. Doch wir bewahren Erinnerungen an kämpferische Ereignisse, die viele derjenigen, die heute die Arbeit des Informationsbüros Nicaragua prägen, selbst nicht mehr bewusst erfahren haben. Hier könnten wir fatalistisch einen Punkt machen oder aufzählen, was die Solidaritätsbewegung auf dem mühsamen Weg der Ebene und der Niederlagen gelernt hat.
| 2. In der nationalen Befreiung im Sinne von Übernahme der Regierungsmacht sehen wir heute keine Perspektive und keinen Bezugspunkt mehr. Entwicklung und Befreiung wird in nationalstaatlich-autarker Form nicht mehr stattfinden können. Die oft versuchte Abkoppelung vom Weltmarkt und eine eigenständige, nationale Entwicklung wird nicht nur an militärischen Interventionen, sondern auch an ökonomischer Erpressung durch die globalen Machtzentren scheitern. 3. Dementsprechend ist auch ein Konzept von Sozialstaatlichkeit nicht unser Modell der Zukunft. Die Verteidigung des Sozialstaats bleibt aber eine Form des vermittelbaren und leistbaren Widerstands und ist zugleich notwendige Verteidigung der eigenen Existenz. Subsistenzproduktion und Nahrungsmittelsouveränität sind unter kapitalistischen Bedingungen notwendige Defensivstrategien, weisen aber sicherlich nicht den Weg in die Zukunft für urbane Gesellschaften. Dies impliziert zugleich den Abschied von einem über-räumlichen und übergesellschaftlichen Modell von Befreiung. Zukünftige Befreiung kann nur in Formen sozialer Netzwerke stattfinden, die in einem konkreten Raum, das heißt in einer gemeinsamen Lebens- und Arbeitsumgebung stattfinden. 4. Dabei entwickeln sich soziale Rebellionen im Kontext vorgegebener räumlich-politischer Bedingungen, sei es die Krise in Argentinien, die Marginalisierung der Indígenas in Chiapas, die Widerstand von Landfrauen in Chinandega gegen Geschlechtergewalt oder Cross-Border-Leasing in Wuppertal. Die Bezugnahme auf den regionalen Kontext bedeutet auch, die jeweiligen lokalen, ganz konkreten Bedürfnisse von Menschen als Subjekten und die gesellschaftlichen, politischen und sozialen Zusammenhänge ernst zu nehmen. Eine Kapitalismuskritik verkommt zum abstrakt-wissenschaftlichen Diskurs ohne praktische Bedeutung, wenn diese konkreten Kämpfe und die dahinter stehenden Zumutungen nicht ernst oder wahrgenommen werden, selbst dann, wenn diese zunächst staatsbezogen bleiben. Wir beziehen uns auf lokale Widerstände und auf konkrete politische Rahmenbe-dingungen, die ihrerseits natürlich entlang nationalstaatlicher Souveränität geschaffen werden. Dabei ist für uns nicht der Ort zentral, sondern ob wir uns mit den Formen und Richtungen dieser Widerstände verbunden fühlen. 5. Da wir es mit konkreten Menschen und konkreten Alltagskämpfen zu tun haben, kommt für uns eine Orientierung an linker Mode-Solidarität nicht in Frage, wir halten an Ländersolidarität fest. Die Orte der sozialen Rebellionen erfahren quasi-automatisch viel Aufmerksamkeit in kritischer und linker Öffentlichkeit und deren Medien. Uns geht es nicht um die Begleitung spektakulärer Prozesse, die mit der Spektakularität abflaut, sondern um Kontinuität und Unterstützung auch in den kleinen, wenig sichtbaren Mühen. Wir wollen in unserer Informationsarbeit die Lebensbedingungen und die alltäglichen Auseinandersetzungen um Brot und Würde und die Bedingungen die aus einer verlorenen Revolution entstanden sind, darstellen.Zentral für das Festhalten an Nicaragua und Mittelamerika sind unsere persönlichen Bezüge und inhaltlichen Kompetenzen, die aus den Diskussionen und den Kontakten entstanden sind und unsere historisch gewachsenen Beziehungen in der „Entwicklungs-“ und „Projekt-„Politik . | |
| 6. In der Projektarbeit haben wir einen Standard an Kooperation, den wir s nicht aufgeben wollen. Die Arbeit unserer ProjektpartnerInnen korrespondiert in vielen Aspekten mit unserer eigenen politischen Analyse. Eine solche Zusammenarbeit wäre mit Organisationen in anderen Ländern nur durch eine lange Vorarbeit denkbar. Nicaragua nimmt durch unsere persönliche Geschichte, für unsere Hoffnungen auf ein besseres Leben und durch die Begegnungen mit den Menschen dort eine besondere Stellung ein. Entlang der Symbolkraft dieses Landes lässt sich auch die Geschichte der Solidaritätsbewegung bzw. der internationalistischen Bewegung, die Bestandteil unseres politischen Selbstverständnisses ist, darstellen und festhalten. 7. Unsere Ländersolidarität steht der Beteiligung an Antiglobalisierungsbewegungen nicht entgegen: So ist die Situation in Nicaragua beispielhaft für die Verteilungs- Macht,- und Herrschaftsstrukturen in der gesamten Welt. Auch die Formen und Inhalte der sozialen Kämpfe der Menschen gleichen sich, da es der Widerstand gegen Verwertungsformen ist, die mit dem Herr-schaftsbegriff „Globalisierung“ ausgedrückt werden. Das ist ein Grund, warum die nationalen Unterschiede dieses Widerstands immer weiter abnehmen. Da sich Ausdruck und Auswirkungen von Herrschaft weltweit angleichen, werden zumindest wichtige Aspekte des Kapitalismus in beliebigen Regionen immer generalisierbarer. Deshalb können wir in der Informations- und Bildungsarbeit globalisierungskritische Kampagnen gegen Privatisierung; Freisetzung von Arbeitskraft; Maquilarisierung der Arbeit, patriarchale Gewalt, Freihandelszonen, Land- und Ressourcenverteilung, Alternativhandel u.s.w. mit unseren Länderkompetenzen hervorragend ergänzen. |