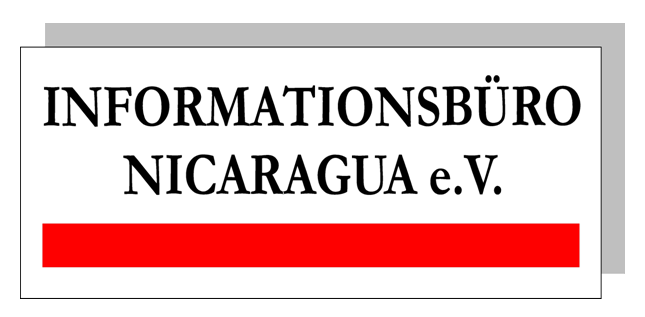https://www.facebook.com/pablo.guillenzeledon (Pablo Zeledón, 6.1.2026 FB)
Spanische Originalversion, siehe unten
Es gibt etwas, das sich in diesen Tagen wiederholt und wozu ohne Umschweife einmal etwas gesagt werden muss:
Die Wut richtet sich nicht nur gegen die Intervention, sondern auch gegen diejenigen, die sie begrüßen. Man wirft ihnen Naivität, Manipulation und Unverständnis für die Geschichte vor. Von ihnen wird absolute politische Reinheit verlangt, eine makellose Haltung selbst angesichts des Leids. Eine grundlegende Frage wird dabei fast nie gestellt: Von wo aus wird all das gefordert?
Viele, die heute wütend schreiben, tun dies aus Demokratien, in denen das Protestieren vor einer Botschaft nicht mit Gefängnis bestraft wird. Wo die Polizei die Demonstration schützt und am Ende jeder ruhig nach Hause zurückkehrt. Von dort aus werden wütende Texte veröffentlicht, in denen erklärt wird, dass „die Völker ihre eigenen Freiheiten aufbauen müssen”. Hoffentlich könnten die Menschen in den Ländern, über die so selbstbewusst geschrieben wird, dies auch tun.
Denn für Millionen Venezolaner ist diese Frage keine theoretische. Es handelt sich weder um eine akademische Debatte noch um eine Übung in ideologischer Kohärenz. Es ist eine brutale Frage: Wie kann man Freiheit aufbauen, wenn Wahlen nichts bringen, Protestieren tödlich ist und Organisieren zu Gefängnis oder Exil führt? Hier bricht die Romantik zusammen.
Zu sagen, dass alles „von innen heraus“ gelöst werden muss, wenn alle internen Wege versperrt sind, ist keine Verteidigung der Selbstbestimmung. Es bedeutet, die moralische Last auf diejenigen zu verlagern, die bereits unter der Unterdrückung leiden. Es bedeutet, von den Unterdrückten zu verlangen, dass sie allein lösen, was das gesamte System ihnen unmöglich macht.
Max Weber warnte, dass eine Ethik der Überzeugung, die die Konsequenzen ignoriert, zu moralischer Verantwortungslosigkeit führen kann. Hier geschieht etwas Ähnliches: Von den Opfern wird perfekte Kohärenz verlangt, während die Brutalität der Macht im Namen einer angeblichen Reinheit der Prinzipien toleriert wird.
Es gibt noch ein weiteres Paradoxon, das noch unangenehmer ist. Für manche schien Venezuela vor dem 3. Januar 2026 „besser” zu sein. Stabiler. Weniger Lärm. Weniger internationale Spannungen. Aber diese Stabilität war kein Frieden, sondern Gewohnheit. Es war eine Diktatur, die ohne sichtbare Turbulenzen funktionierte.
Hannah Arendt hat es klar gesagt: Autoritäre Regime fallen nicht, wenn sie gewalttätiger werden, sondern wenn ihre Gewalt nicht mehr unsichtbar ist. Und dieser Moment ist immer unangenehm. Sogar – und vor allem – für diejenigen, die behaupten, die Menschenrechte zu verteidigen.
Deshalb richtet sich die Wut nicht nur gegen die Intervention. Sie richtet sich gegen den Bruch einer autoritären Ordnung, die bereits normalisiert, in die Landschaft integriert und als „das, was ist” akzeptiert worden war. Daraus entsteht ein Großteil dieser Empörung.
Pierre Bourdieu würde helfen, dies zu benennen: Privilegien neigen dazu, ihre Erfahrung zu universalisieren. Aus der Sicherheit heraus werden denen, die unter Bedrohung leben, moralische Lektionen erteilt. Aus der Freiheit heraus wird von denen, die keinen Spielraum mehr haben, unendliche Geduld verlangt. Denn was viele feiern, ist keine Geopolitik. Es ist keine Macht. Es ist kein Imperium.
Es ist etwas viel Kleineres und Menschlicheres: Erleichterung. Eine fragile Hoffnung. Das Gefühl – wenn auch nur für einen Moment –, dass sich nach Jahren der politischen Isolation etwas bewegt hat.
Es sollte klar gesagt werden:
Feiern bedeutet nicht, den Krieg zu bejubeln.
Feiern bedeutet nicht, die Interessen der Mächte zu ignorieren.
Feiern bedeutet auch nicht, auf Kritik zu verzichten.
Feiern bedeutet manchmal einfach, nach langer Zeit wieder durchzuatmen.
Michael Walzer sprach von politischer Tragödie, um Szenarien zu beschreiben, in denen es keine sauberen Auswege gibt. In denen alle Optionen schlecht sind, aber nicht alle gleich schwer auf diejenigen lasten, die unter dem Regime leben. Von außen ist es leicht, perfekte Kohärenz zu fordern. Von innen heraus ist das Leben nicht so organisiert.
Vielleicht ist das Problem nicht, dass einige feiern. Vielleicht ist das Problem, dass andere nur verurteilen können, ohne eine echte Alternative anzubieten, ohne die Kosten ihrer eigenen Kohärenz zu tragen und ohne sich zu fragen, ob ihre Empörung nicht dazu beiträgt, dass alles beim Alten bleibt.
Das ist das Unbehagen, das man nicht sehen will.
Und ohne es zu sehen, bleibt jede Debatte über Venezuela unvollständig.
Spanische Originalversion:
Hay algo que se repite en estos días y que merece ser dicho sin rodeos: el enojo no es solo contra la intervención, sino contra quienes celebran. Se les acusa de ingenuos, de manipulados, de no entender la historia. Se les exige una pureza política absoluta, una postura impecable incluso frente al dolor. Casi nunca se pregunta algo básico: ¿desde dónde se exige todo eso? Muchos de quienes hoy escriben con furia lo hacen desde democracias donde protestar frente a una embajada no implica cárcel. Donde la policía cuida la manifestación y, al terminar, cada quien vuelve tranquilo a su casa. Desde ahí se publican textos airados explicando que “los pueblos deben construir sus propias libertades”.
Ojalá —literalmente— en los países sobre los que se escribe con tanta seguridad, la gente pudiera hacerlo. Porque para millones de venezolanos la pregunta no es teórica. No es un debate académico ni un ejercicio de coherencia ideológica. Es una pregunta cruda:¿cómo se construye libertad cuando votar no sirve, protestar mata y organizarse conduce a la cárcel o al exilio? Ahí se rompe el romanticismo.
Decir que todo debe resolverse “desde adentro” cuando todas las vías internas han sido cerradas no es defensa de la autodeterminación. Es trasladar la carga moral a quienes ya cargan con la represión. Es pedirle al oprimido que resuelva solo lo que el sistema entero le impide resolver.
Max Weber advertía que una ética de la convicción que ignora las consecuencias puede convertirse en irresponsabilidad moral. Algo parecido ocurre aquí: se exige coherencia perfecta a las víctimas mientras se tolera la brutalidad del poder en nombre de una supuesta pureza de principios.
Hay otra paradoja que incomoda todavía más. Para algunos, Venezuela parecía “mejor” antes del 3 de enero de 2026. Más estable. Menos ruido. Menos tensión internacional. Pero esa estabilidad no era paz; era costumbre. Era una dictadura funcionando sin sobresaltos visibles.
Hannah Arendt lo dijo con claridad: los regímenes autoritarios no caen cuando son más violentos, sino cuando su violencia deja de ser invisible. Y ese momento siempre incomoda. Incluso —y sobre todo— a quienes dicen defender los derechos humanos.
Por eso el enojo no es solo contra la intervención. Es contra la ruptura de un orden autoritario que ya había sido normalizado, incorporado al paisaje, aceptado como “lo que hay”. Desde ahí nace buena parte de esta indignación.
Pierre Bourdieu ayudaría a nombrarlo: el privilegio tiende a universalizar su experiencia. Desde la seguridad se dictan lecciones morales a quienes viven bajo amenaza. Desde la libertad se exige paciencia infinita a quienes ya no tienen margen. Porque lo que muchos celebran no es geopolítica. No es poder. No es imperio.
Es algo mucho más pequeño y más humano: alivio. Una esperanza frágil. La sensación —aunque sea momentánea— de que algo se movió después de años de encierro político.
Conviene decirlo sin rodeos:
celebrar no es aplaudir la guerra.
Celebrar no es ignorar los intereses de las potencias.
Celebrar tampoco es renunciar a la crítica.
Celebrar, a veces, es simplemente respirar después de mucho tiempo.
Michael Walzer hablaba de tragedia política para referirse a escenarios donde no hay salidas limpias. Donde todas las opciones son malas, pero no todas pesan igual sobre quienes viven dentro del régimen. Desde afuera es fácil exigir coherencia perfecta. Desde adentro, la vida no se organiza así. Tal vez el problema no es que algunos celebren. Tal vez el problema es que otros solo saben condenar, sin ofrecer una alternativa real, sin asumir el costo de su propia coherencia y sin preguntarse si su indignación no termina siendo funcional a que todo siga igual. Esa es la incomodidad que no se quiere mirar.
Y sin mirarla, cualquier debate sobre Venezuela queda incompleto.